von Sven-Uwe Janietz
Ein Held unserer Zeit?
Im Jahre 1837 starb Alexander Puschkin im Duell. Vier Jahre
darauf erlag auch Michail Lermontow seinen Verletzungen aus einem Zweikampf.
Vielleicht ist der Duelltod seinerzeit natürlicher Teil der Dichterlaufbahn
gewesen. Während wir Puschkin heute als den russischen Nationaldichter
schlechthin kennen, wird Lermontow fast immer nur im Zusammenhang mit einem
Roman genannt: Ein Held unserer Zeit.
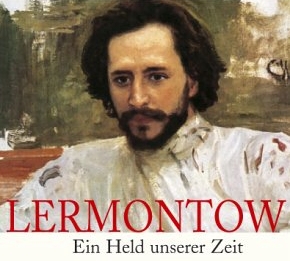
Buchtitel des deutschen insel-Taschenbuchs
Vom Umschlag der deutschen Taschenbuchausgabe schaut uns ein
Jüngling entgegen (Leoind Andrejew, gemalt vom Ilja Repin 1904), der edelmütiges
erwarten lässt. Doch die Vermutung, dass unser Held einer ist, der uns
nachahmenswerte Tüchtigkeiten vorlebt, wird schon bei der Lektüre
des Vorworts zerstört. Im Gegenteil, diese Person ist, so Lermontow, „tatsächlich
ein Porträt, aber nicht das eines einzelnen Menschen; es ist ein Porträt,
das sich aus den voll ausgereiften Lastern unserer ganzen Generation zusammensetzt.“(LERMONTOW
S.12) Haben wir es also hier mit einem besonders lasterhaften, womöglich
gar bösen Menschen zu tun, den wir höchstens mit sarkastischer Ironie
einen Helden nennen dürfen? Oder finden wir Gründe dafür, dass
wir es mit einem „echten“ Helden zu tun haben? Diese Frage möchte
ich in den folgenden Abschnitten verfolgen.
Die Geschichte des Petschorin
Dem Erzähler wird bei der Reise durch den Kaukasus von einem alten russischen
Truppenkommandeur (Maximytsch), der schon lange vor Ort ist, eine Anekdote anvertraut:
Eines Tages kam der junge und reiche Offizier Petschorin in sein Lager, der
sich eben hatte aus Russland dorthin versetzen lassen. Scheinbar aus Langeweile
inszeniert Petschorin eine Intrige: er spielt zwei Figuren gegeneinander aus,
indem er der einen die Möglichkeit zum ungehinderten Diebstahl des begehrenswerten
und edlen Pferdes der anderen Figur verschafft und sich dadurch – quasi
als Preis für seine Gefälligkeit – in den Besitz der bezaubernden
Tochter des lokalen Tscherkessenfürsten bringt. Der Offizier kommt damit
durch und gewinnt mit seinen galanten Umgangsformen nach und nach die Zuneigung
des Mädchens (Bela). Doch Petschorin treibt nur sein Spiel, sobald ihm
Bela ihre Zuneigung zeigt, erlischt sein Interesse an ihr und er widmet sich
neuen Arten des Zeitvertreibs. Infolge eines Racheaktes durch den Bestohlenen
stirbt Bela kurze Zeit darauf und Petschorin zieht es vor zu einer anderen Kompanie
versetzt zu werden.
In der Zeit, als sich Petschorin angeödet von dem Mädchen
abwendet, berichtet er Maximytsch: „ich habe einen unglückseligen
Charakter; ob mich die Erziehung so gemacht hat oder Gott so erschaffen hat,
weiß ich nicht, ich weiß nur, daß ich, wenn ich das Unglück
anderer verschulde, selbst nicht weniger unglücklich bin.“ (LERMONTOW
S.51) Da Petschorin, wie wir später erfahren werden, bis zu diesem Zeitpunkt
schon sehr viel Unglück (mehr oder weniger absichtlich) bei anderen angerichtet
hat, müsste er selbst also auch sehr viel Unglück erfahren haben.
Gewöhnlich strebt der Mensch nach dem Glück, unter Umständen
selbst dann, wenn es durch das Unglück anderer bedingt ist. Petschorin
wird mit der Feststellung seines „unglückseligen Charakters“
also nicht sagen wollen, dass ausgerechnet er nach dem Unglück strebe –
dass ihn das Unglück selig mache. Aber auch nicht, dass sein Glück
das Unglück der anderen ist, denn er selbst ist ja, nach eigenem Bezeugen,
dabei der Unglücklichere. Wie kommt es zu so einer – für alle
Beteiligten – misslichen Lebenslage? Nun kann es natürlich sein,
dass jemand weiß, was für das eigene Glück realistischer Weise
zu tun wäre, es aber trotzdem nicht tut (z.B. ein abstinenzwilliger Raucher,
ein beliebtes Beispiel ist auch Gontscharows Romanfigur Oblomow). So ein Fall
von Willensschwäche scheint aber nicht bei unserem Helden vorzuliegen,
der sich an manchen Stellen sogar als besonders entschlossen entpuppt. Eher
will es so aussehen, als ob Petschorin schlicht keinen Schimmer davon hat, worin
er glücklich handeln und werden sollte. Immerhin hat er schon einige der
üblichen Zielangebote bezüglich ihres Infragekommens abgehakt: „In
meiner frühesten Jugend, von dem Augenblick an, da ich meine elterliche
Obhut verließ, gab ich mich wild allen Genüssen hin, die man für
Geld haben kann, und diese Genüsse wurden mir selbstverständlich zuwider.
Dann stürzte ich mich in die große Welt, aber bald ödete mich
auch die Gesellschaft an; ich verliebte mich in vornehme Schönheiten und
wurde wiedergeliebt, doch deren Liebe stachelte nur meine Phantasie und meine
Eigenliebe an; das Herz blieb leer… Ich begann zu lesen, zu studieren
– auch der Wissenschaften wurde ich überdrüssig; ich sah, daß
weder Ruhm noch Glück von ihnen abhängen; weil die glücklichsten
Menschen die Unwissenden sind, und Ruhm und Erfolg – um sie zu gewinnen
muss man nichts als geschickt sein! Da überkam mich Langeweile… Ich
hoffte mir würde die Langeweile unter dem Kugelregen der Tschetschenzen
[= Tescherkessen, Kaukasusvolk] vergehen.“(LERMONTOW S.51)
Damit lässt sich Petschorin schon ein wenig besser nachvollziehen. Wenn
sämtliche nahe liegenden Tätigkeiten des Sinnverleihs für einen
nicht in Frage kommen, ist tatsächlich eine Ziellosigkeit zu diagnostizieren,
die sich im Handeln als Planlosigkeit und im Befinden als Langeweile äußert.
Wenn man sich also erneut fragt, was Petschorin mit seinem „unglückseligen
Charakter“ meint, bleiben augenscheinlich drei Möglichkeiten. Erstens:
er weiß nicht, wie „Glückseligkeit“ für ihn aussieht
und bleibt daher unglücklich, das war in etwa die letzte Überlegung.
Zweitens: er macht andere Menschen und damit sich selbst unglücklich ohne
es zu erstreben. Dann ist er entweder in einer gewissen Weise irrational oder
willensschwach. Unter diese Kategorie fallen vielleicht auch Leute, denen ständig
unglückliche Zufälle passieren (so einer ist Petschorin aber nicht).
Drittens: er macht andere Menschen und damit sich selbst unglücklich, und
zwar absichtlich. Dann wäre er – jemand, der nach dem Unglück
strebt – bestenfalls (bezüglich seines eigenen Unglücks) eine
tragische Figur und schlimmstenfalls (bezüglich des von ihm verursachten
Unglücks anderer) eine wirklich böse. Bemerkenswert ist gewiss auch
die These, dass die Unwissenden die Glücklichsten sind. Obwohl dies im
Widerspruch mit den eingehenden Analysen des Aristoteles steht, dürfte
es als empirischer Befund erstaunlich zustimmungsfähig sein. Die Bela-Episode
hat bereits vorweggenommen, dass es Petschorin auch auf dem „Feld der
Ehre“und „im Kugelregen“ nicht gelingen wird sein Glücksproblem
zu lösen.
Wie es der Zufall will, kommt just an dem Tag, nachdem Maximytsch
dem Erzähler von ihm berichtet hatte, Petschorin am Aufenthaltsort der
beiden vorbeigereist. Maximytsch ist außer sich vor Freude und versucht
ein Wiedersehen zu arrangieren. Der alte Offizier wird jedoch durch Petschorin
ordentlich versetzt und als er dann endlich auftaucht erweist sich sein Auftreten
als sehr distanziert und nahe am Arroganten. Nur an dieser einzigen Stelle erhält
man aber auch eine Beschreibung der visuellen Erscheinung Petschorins durch
den Erzähler: er ist von mittlerer Größe, schlank, geschmeidig,
breitschuldrig, gesund etc. und trägt blendend weiße Wäsche,
die seine ordentliches und aristokratisches Wesen bezeugt. Auch erfährt
man, dass Petschorin sich auf einer abenteuerlichen Reise nach Persien befindet,
bei der die Chancen, niemals zurückzukehren, nicht schlecht stehen. Für
den reichlich sentimentalen Maximytsch ist die Begegnung freilich sehr frustrierend
und wir hören aus seinem Mund, was man auch selbst bei der vorangegangenen
Beschreibung empfunden hat: „Ich habe ja immer gewusst, daß
er ein Leichtfuß ist, auf den man sich nicht verlassen kann… Ich
habe immer schon gesagt, an einem Menschen, der seine alten Freunde vergisst,
ist nichts Gutes dran!“(LERMONTOW S.72) Mit jeder weiteren Anekdote
wird der Charakter des Helden, der ja vermeintlich sämtliche Laster enthalten
soll, deutlicher umrissen. Am Beispiel des Maximytsch ist klar geworden: auch
Freundschaft ist für Petschorin kein besonders hohes Gut. Damit scheidet
für den Helden ein weiteres klassisches Bestimmungsstück des Glücks
aus. Für den Fortgang der Geschichte zumindest erweist es sich aber als
großer Vorteil, dass der gelangweilte Petschorin – in der Erwartung
seines Todes auf der vor ihm liegenden Reise – Maximytsch seine Tagebücher
überlässt. Jener ist aber derart empört, dass er nichts mehr
mit Petschorin zu tun haben mag und die Aufzeichnungen dem Erzähler aushändigt.
Die Tagebücher des Petschorin machen dann die verbleibenden zwei Drittel
des Romans aus.
Es ist auf die beachtliche Komplexität der Erzählweisen in Lermontows
Buch hinzuweisen. Der Leser erhält in nichtchronologischer Weise drei Perspektiven
auf den Helden. Zuerst berichtet ein dritter (Maximytsch) als Freund über
Petschorin, dann schildert der Erzähler als Außenstehender aus der
ersten Person seinen Eindruck und schließlich wird der Held in den Tagebüchern
seine eigene Sicht erläutern. Dieses Vorgehen erweist sich für die
Charakterstudie als ziemlich ergiebig.

Michail Lermontow
Die erste Episode aus den Tagebüchern führt Petschorin
in die die Hafenstadt Taman, wo er als Durchreisender einige Tage auf ein Schiff
warten muss. Er bezieht Quartier im heruntergekommenen Haus einer alten Frau.
Als er zufällig bemerkt, dass die attraktive Tochter und der blinde Adoptivsohn
ihre ärmliche Existenz durch nächtliche Schmuggelaktivitäten
aufbessern, nutzt er sein Wissen um sich dem Mädchen zweideutig zu nähern.
Die Tochter versucht in ihrer Verzweiflung Petschorin aus dem Weg zu schaffen
und muss nach dem erfolglosen Versuch fliehen. Die Familie zerbricht und der
blinde Junge bleibt allein zurück:“ der Junge weinte wirklich,
und lange, lange… Mir wurde schwer ums Herz. Wozu hatte das Schicksal
mich in den friedlichen Kreis ehrlicher Schmuggler verschlagen? Wie ein Stein,
den man in ein glattes Gewässer wirft, habe ich ihre Ruhe gestört
[…] Was aus der Alten und dem armen Blinden wurde – ich
weiß es nicht. Was scheren mich die Freuden und Leiden der Menschen, mich,
einen reisenden Offizier.“(LERMONTOW S.92) Was an der Anekdote verstört,
sind die absehbar negativen Folgen seines Tuns in Verbindung mit der schwachen
positiven Motivation dafür (er hält sie für „beileibe keine
Schönheit“ und ist allenfalls für einen Augenblick entzückt
von ihr). Es ist nicht der Fall, dass es Petschorin auf das Mädchen abgesehen
hätte und das (zweifellos unredliche) Ziel verfolgte, sie sich durch Erpressung
gefügig zu machen. Vielmehr scheint es die bloße Neugier auf ihre
Reaktion zu sein, die ihn dazu bringt, mit dem Verrat zu drohen, obwohl er genau
abschätzen kann, dass er sie damit in eine äußerst prekäre
Situation versetzt. (Nachdem die Tochter seinen verbalen Annäherungsversuchen
eine Weile mit kryptischen Erwiderungen entkommen ist, antwortet der Held in
spielerischer Drohung: „Und doch weiß ich etwas von dir…“
um sie dann mit seinem Wissen in die Enge zu treiben). Auch ist Petschorins
kurzer und flüchtiger – schließlich ganz und gar zurückgenommener
– Anflug von schlechtem Gewissen alles andere als ein Hinweis darauf,
dass er selbst genauso unglücklich wäre, wie diejenigen, die er dazu
gemacht hat. Mit dieser schwach motivierten, egoistisch wertlosen Handlungsweise
(er ist nachher unglücklicher als davor) mit schlechten Folgen für
andere, erweist sich Petschorin das erste Mal deutlich als bösartige Natur.
Die wichtigste und längste Episode aus den Aufzeichnungen handelt von der
Prinzess Mary und ist zeitlich allen andern Episoden vorausgegangen. Petschorin
ist für einige Zeit in einem kleinen kaukasischen Kurort, wo eine Gruppe
russischer Adliger und Gutsbesitzer im Urlaub verweilt und auch zahlreiche Offiziere
von der kämpfenden Truppe sich zur Genesung aufhalten. Der Held trifft
dort zufällig den Junker Gruschintzki, einen alten Bekannten vom Militär.
Der Umgang der beiden ist nach außen freundschaftlich, aber Petschorin
hegt insgeheim Unsympathie für den anderen, weil er dessen romantisierende
Art für witzlos hält. Gruschintzki hat sich bis über beide Ohren
in die junge Prinzess Mary verliebt, die er in Gesellschaft mit geistreicher
Unterhaltung und Charme zu gewinnen versucht. Obwohl Petschorin kein aufrichtiges
Interesse für die Prinzess empfindet, macht auch er ihr – oft auf
Kosten des anderen – den Hof. Mary verliebt sich in den Helden und weist
Gruschintzki ab. Der Junker will sich nun rächen, es kommt zum Duell und
Gruschintzki wird getötet. Petschorin erklärt Mary, dass er sie niemals
heiraten wird und verlässt den Ort.
Während er der Prinzess noch Avancen macht, fragt sich
Petschorin: “warum ich so beharrlich nach der Liebe eines jungen Mädchens
trachte, das ich nicht verführen will und nie heiraten werde… Wenn
ich sie für eine unnahbare Schönheit hielte, würde mich vielleicht
die Schwierigkeit des Unternehmens reizen. Aber all das trifft nicht zu. Folglich
ist es nicht jenes unruhige Liebesverlangen, das uns von einer Frau zur anderen
treibt, bis wir eine finden, die uns nicht mag: Hier beginnt dann unsere Beständigkeit,
die wahre unendliche Leidenschaft… das Geheimnis dieser Unendlichkeit
liegt nur in der Unmöglichkeit, das Ziel, das heißt das Ende, zu
erreichen. Warum bemühe ich mich so? Aus Neid auf Gruschintzki?... Oder
ist das die Folge jenes hässlichen, aber unbesiegbaren Gefühls, das
uns veranlasst, die süßen Verirrungen unseres Nächsten zu zerstören,
um das heimliche Vergnügen zu haben, ihm auf seine verzweifelte Frage,
woran er glauben solle, zu antworten: »Mein Freund, mir ist es ebenso
ergangen! Doch du siehst, ich esse zu Mittag, esse zu Abend, schlafe gut und
hoffe, ich werde einst ohne Geschrei und Tränen zu sterben verstehen.«“(LERMONTOW
S.136) Zunächst wird dem Leser hier eine interessante Lektion über
das Wesen der leidenschaftlichen Liebe angeboten. Das Liebesverlangen kann demnach
nicht durch das entsprechende Verlangen bei der Geliebten befriedigt werden,
sondern erfährt seine Befriedigung gerade darin, dass es nicht sein Ziel
erreicht. Erwiderte Liebe ist dabei das Ende der Leidenschaft. Die Liebesleidenschaft
ist – so bestimmt – ein ganz sonderbares Streben. Es ist in konstitutiver
Weise auf ein Ziel ausgerichtet (man kann nicht leidenschaftlich lieben, wenn
man kein Objekt der Begierde hat), aber hat sein wichtigstes Gut ganz allein
in sich selbst. So gesehen ist die Liebe tatsächlich ein „seltsames
Spiel“, denn auch ein Spiel (im engeren Sinn) bedarf unbedingt solcher
Teilnehmer, die das Ziel des Gewinnens erstreben, dennoch liegt der Zweck des
Spiels oft im Spielen selbst und nicht im Ergebnis (dem Gewinnen). Wären
wir alle wie Petschorin beschaffen, dann gäbe es keine Liebesbeziehungen.
Aber die Prinzess ist für den Helden noch nicht einmal ein Objekt der Begierde
(sowenig wie es in Taman die Tochter gewesen ist), sondern ein – im Prinzip
verzichtbarer – Stein in einem Spiel. Wenn Petschorin die Prinzess aber
gar nicht selbst haben will, dann kann er Gruschintzki auch nicht um sie beneiden.
Und es will scheinen als sei das, worauf er wirklich neidisch sein könnte,
allein das mögliche Glück, die „süße Verirrung“
seines Bekannten. Und wozu das? Was könnte Petschorin dazu treiben, alle
glücklicheren Menschen auf sein deprimierendes Niveau herabholen zu wollen?
Ich denke, dass man spätestens an dieser Stelle die anfängliche These,
dass ihn selbst das durch ihn verursachte Unglück am unglücklichsten
mache, verwerfen muss. Andernfalls wäre er der einzige Mensch, der durch
sein Tun das eigene Unglück erstrebt. Zwar weiß der Mann nicht, worin
sein Glück besteht, aber er kennt doch offenbar verschiedene Grade des
Unglücklich-Seins. Folglich muss er, wenn er in einem Zustand unglücklicher
ist als in einem anderen, doch wohl auch meinen, dass der zweite Zustand glücklicher
ist als der erste. Daher muss er zumindest über ein Kriterium verfügen,
was glücklichere von weniger glücklicheren und erstrebenswerte von
weniger erstrebenswerten Zuständen unterscheidet, ohne jedoch freilich
damit schon ein oberstes Gut im Streben kennen zu müssen. Wenn er denn,
wie im Gruschintzki/Mary-Beispiel so handelt, dass er nachher (unter Anerkennung
der fraglichen These vom eigenen Unglück) unglücklicher sein muss,
dann handelt er entweder sehr unschlau (irrational) bzw. willensschwach oder
aber (unter Verwerfung der fraglichen These) es macht ihn in Wirklichkeit glücklicher,
andere unglücklich zu machen (Schadenfreude). Ich halte die letzte Vermutung
für zutreffend. Erstens gibt Petschorin nicht den Eindruck, dass es ihm
an instrumenteller Schlauheit mangelt (die These von der Willensschwäche
ist noch zu prüfen), und zweitens spricht er von einem „heimlichen
Vergnügen“, wenn er dem Unglücklichen dann das eigene Unglück
vorhält. Der Verdacht erhärtet sich durch Petschorins eigene Überlegungen:
„ich betrachte die Freuden und Leiden der anderen nur im Zusammenhang
mit mir, wie eine Speise, die meine seelischen Kräfte erhält…
Für einen anderen Menschen Ursache zu Leiden und Freuden zu werden, ohne
wirklich dazu berechtigt zu sein – ist dies nicht die süßeste
Speise für unseren Stolz? Und was ist denn Glück? Befriedigter Stolz.“
(LERMONTOW S.137) Hier wird behauptet, dass das eigene Glück, vermittelt
durch einen nebulösen Stolz, eine Funktion vom Glück anderer ist.
Das Glück von A ist aber danach nur von demjenigen Glück anderer abhängig,
welches seine Ursache in der Person A hat. Auch ist damit nicht gesagt, dass
das eigene Glück ausschließlich vom Glück anderer abhängig
wäre, sondern es mögen auch noch andere Faktoren dafür relevant
sein. Was hiermit beschrieben wird, und was Petschorin auch zugibt, ist ein
Streben nach Macht über andere. Macht bedeutet Einfluss auf das Leben anderer,
Ursache sein zu können für deren Leiden und Freuden. So kann derjenige,
der sein eigenes Glück aus dem Einfluss auf das Glück der anderen
bezieht, eigentlich nur nach Macht streben. Nun ist das Machtstreben nicht an
sich etwas schlechtes, sondern ist als Phänomen des Politischen und Intersubjektiven
sogar notwendig. Staatskunst ist ja nicht zuletzt, dass der Mächtige zur
(Mit-)Ursache des Glücks der einzelnen wird. Jedoch ist das Machstreben
dann gefährlich, wenn jemand Ursache für Glück und Unglück
anderer ist, der nicht nach deren Glück strebt, wenn also die Ziele der
Politik und des einzelnen auseinander fallen. Petschorins Machtsreben ist so
ein gefährliches, das zwar nicht in einem ganzen Staat, aber doch in seinem
Umfeld aktiv das Unglück vermehrt. In der Gruschintzki/Mary-Episode wird
auch noch Petschorins fehl gelaufene Erziehung beschrieben, die ihn zu einem
„moralischen Krüppel“ gemacht habe und es blitzt immer wieder
seine boshafte Geringschätzung für einige seiner Mitmenschen durch.
Am Ende des Romans steht dann die Episode „Der Fatalist“, die unserem
Charakterbild des Helden allerdings nicht mehr viel hinzufügt.
Ein unglückseliger Charakter?
Es ist aber die Frage noch nicht ganz geklärt, in welchem Sinne Petschorins
Charakter unglückselig sein mag. Bei der Analyse der Bela-Episode hatte
ich drei Interpretationsweisen unterschieden. Zu dieser Zeit war auch schon
die erste wesentliche Randbedingung bekannt: (A) Wenn Petschorin andere unglücklich
macht, ist er selbst auch genauso unglücklich darüber. Inzwischen
hat sich aber eine weitere – in der Mary-Episode gewonnene – Randbedingung
ergeben: (B) sofern er selbst ursächlich ist, ist das Glück oder Unglück
anderer ein Glück für Petschorin. Die beiden Randbedingungen des Petschorinschen
Charakters sind meines Erachtens partiell unvereinbar. Wenn nämlich das
von ihm verursachte Unglück anderer ihn genauso unglücklich macht
(vgl. A), kann ihn dieses Unglück anderer nicht zugleich glücklich
machen (vgl. B). (A) und (B) sind hingegen vereinbar wenn Petschorin die Ursache
für das Glück anderer ist – nur ist der Held im ganzen Roman
jemand, der den anderen Unglück bringt. Es sollten nun also die fraglichen
Interpretationen unter Verwendung der beiden Randbedingungen geprüft werden.
Die erste Auslegung bestand darin, dass Petschorin nicht weiß, was „Glückseligkeit“
für ihn bedeutet. Ihm fehlt ein konstantes Ziel im Streben, sein Handeln
ist insgesamt planlos und macht ihn nicht anhaltend glücklich. Diese Vermutung
wird – wie sich oben gezeigt hat – durch einige Textstellen gestützt
und lässt sich auch in Kohärenz mit den beiden Randbedingungen aufrechterhalten
(insofern diese selbst kohärent sein sollten). Mit Randbedingung (A) wird
der Held selbst unglücklich, indem er andere unglücklich macht. Somit
kennt er verschiedene Grade des Unglücks/Glücks, denn sonst könnte
er gar nicht wissen, dass er unglücklich ist. Dies bedeutet aber nicht,
dass er über ein anhaltendes Ziel (womöglich ein Endziel) verfügt.
Ich kann auch wissen, dass mich Vanilleeis stets glücklicher macht als
Schokoladeneis, dennoch kann ich daraus noch kein Lebensziel konstruieren. Randbedingung
(B) lässt sich auf analoge Weise integrieren. Wenn Petschorin das Ausspielen
von Macht in einen glücklicheren Zustand versetzt, muss das nicht heißen,
dass er schlechthin nach Macht zu streben hätte.
Die zweite Auslegung von „unglückseliger Charakter“ war, dass
Petschorin eine Tendenz dazu hat, sich und andere unglücklich zu machen,
ohne es wirklich zu wollen. Diese Interpretation möchte am Beispiel der
Willensschwäche untersuchen. Ein Fall von Willensschwäche besitzt
etwa folgende Struktur:
(1) Person P weiß, dass wenn sie p tut, dann q.
(2) P will nicht q.
(3) P tut p.
Für Petschorins Situation sähe das dann folgendermaßen aus:
(1) Petschorin weiß, dass wenn er Mary erobert, er sie unglücklich
machen wird.
(2) Petschorin will Mary nicht unglücklich machen, denn (2b) damit macht
er sich selbst unglücklich
(3) Petschorin handelt so, dass er Mary erobert.
Eine Irrationalität mangels instrumenteller Schlauheit wäre es, wenn
P nicht wüsste, dass p nicht dem zuträglich ist, was sie eigentlich
will. Willensschwachen Personen ist dies aber bekannt und sie tun p trotzdem.
Unserem Helden ist bekannt, dass er Mary unglücklich machen wird, wenn
er so handelt, wie er es tut. Folglich ist er nicht instrumentell unschlau sondern
höchstens willensschwach. Ist Petschorins Verhalten so zu beschreiben?
Wie man sieht, ist die Randbedingung (A), dass das Unglück Marys auch das
Unglück unseres Helden ist, in der Struktur (2b) versteckt. Wir können
(2) nur dann sicher behaupten, wenn wir die Randbedingung (A) voraussetzen.
Da Petschorin hier aber Ursache des Unglücks einer anderen Person wird,
müsste ihn dies nach Randbedingung (B) eigentlich glücklicher machen.
Die Willensschwäche kann also keine gültige Rekonstruktion des Petschorinschen
Verhaltens leisten, da sie auf die Randbedingung (A) in einer Weise angewiesen
ist, die mit Randbedingung (B) im Widerspruch steht.
Die dritte Auslegung des „unglückseligen Charakters“ war, dass
Petschorin sich und andere wissentlich und absichtlich unglücklich macht.
Diese Interpretation ist aber insofern unsinnig, als das es handlungstheoretisch
per Definition ausgeschlossen ist, dass jemand in seinem Unglück ein Endziel
haben könnte. Das ist, also ob ich behaupten wollte, dass bestimmte größer
werdende Dinge kleiner werden. Es wird sich aber vielleicht erweisen, dass diese
dritte Auslegung einen anderen Sinn haben kann.
Es will so scheinen, als sei der „unglückselige Charakter“
aus dem Text nur als einer zu verstehen, dem es an einem klaren hohen Ziel zu
einem anhaltend glücksbringenden Streben mangelt. Damit geht aber –
zumindest nach modernem Verständnis – noch kein Laster einher, das
gute Leben ist kein moralisches Problem. Wenn man aufhört sich zu fragen,
was es mit dem „unglückseligen Charakter“ Petschorins auf sich
hat, bleibt trotzdem das Problem erhalten, sein Verhalten adäquat zu beschreiben.
Wie bei der zweiten und dritten Interpretation deutlich wurde, ist es weder
als (instrumentell) irrationales noch als willensschwaches Handeln und auch
nicht als rationales Glücksstreben zu erfassen. Ich denke, dass uns dieser
Umstand dazu nötigt, wenigstens eine der Randbedingungen zu verwerfen.
Wenn wir die Bedingung (B) partiell aufgeben, können wir verhindern, dass
Petschorin aus dem – von im verursachten – Unglück anderer
Glück zukommt. Damit wäre es möglich sein Verhalten als willensschwach
zu klassifizieren. Wenn wir dagegen Randbedingung (A) streichen, müssen
wir nicht mehr annehmen, dass Petschorin das – wiederum von ihm verursachte
– Unglück anderer selbst unglücklich macht. Mit dieser Modifikation
gewinnt dann plötzlich die dritte Auslegung erheblich an Attraktivität:
indem Petschorin andere wissentlich und absichtlich unglücklich macht,
wird er selbst gar nicht genauso unglücklich, sondern – im Gegenteil
– glücklich, wie es die aufrecht erhaltene Bedingung (B) verlangt.
Ich glaube, dass die letzte These bezüglich Petschorins Verhalten die plausibelste
ist. Der Held strebt oft – völlig gleich ob er eine Vorstellung vom
gelingen seines Lebens hat oder nicht – mit seinem Handeln absichtlich
danach, Ursache des Unglücks seiner Mitmenschen zu werden. Petschorin ist
kein „bloß willensschwacher“ Mensch, sondern ein ausgesprochen
böser.
Ein Held?
Der Erzähler berichtet, bevor wir die Tagebücher zu
lesen bekommen, dass Petschorin tatsächlich auf der Persienreise zu Tode
gekommen ist. Dabei wirft eben die Frage auf, welche ich diesem Roman-Durchgang
vorangestellt habe: „Vielleicht wollen einige Leser meine Meinung
über Petschorins Charakter erfahren. Meine Antwort ist die Überschrift
dieses Buches. »Aber das ist doch boshafte Ironie!« werden sie sagen.
– Ich weiß es nicht.“(LERMONTOW S.77) Um diese Frage
zu klären, wird man nicht umhinkommen, genauer zu klären, was genau
denn mit „Held“ gemeint sei. Ich möchte zumindest zwei Verwendungsweisen
unterscheiden. Der erste Held ist der moralische Held, sein Gegenpart ist der
Schurke oder der Feigling. Der moralische Held lebt uns in besonders exemplarischer
Weise Tugenden vor: Dabei kann der Held unter Umständen in ziemlich unangenehme
Situationen geraten (etwa Ödipus, als er von seinem Vatermord erfährt)
und in Ausübung der Tugend zum tragischen Helden werden. Da in der Antike
die Körperkraft und von großer Bedeutung und die Pflege derselben
eine Tugend war, verfügen die Helden der griechischen Mythologie meistens
über große Stärke. Damit sind sie aber nicht nur gut gegen ihre
Gegner gewappnet, sondern auch, weil der Tugend gemäß, besondere
moralische Helden. Der zweite Typ des Helden ist die Hauptfigur einer aussagekräftigen
Geschichte, der Held eines Romans. Die Hauptfiguren der Geschichten des Altertums
waren gerne die moralischen Helden, daher kommt vielleicht die Quasigleichsetzung
von Hauptfigur und Held. Nun sind die Romanhelden unserer Zeit längst nicht
mehr unbedingt jene vortrefflichen moralischen Helden, sondern oft zerrissene
(z.B. Frischs Stiller) oder ganz und gar bösartige Charaktere
(z.B. in Capotes Kaltblütig). Aber auch der Romanheld zeigt uns
– wenngleich nicht die Tugend, wie der moralische Held – etwas interessantes
und wesentliches Menschliches und nicht nichts. Meine Meinung bezüglich
Petschorin: er ist auf keinen Fall ein moralischer Held, aber ein guter –
obwohl böser – Romanheld. Nun mag man die Feststellung, dass Petschorin
Hauptfigur eines Romans ist (das ist es ja, was ich im letzten Satz eigentlich
gesagt habe) für ziemlich trivial halten, dazu müsse man ja nur das
Buch aufschlagen. Doch kommt es darauf an, was uns Petschorin interessantes
Menschliches zu sagen hat, denn das ist es, worin sich der Romanheld von der
bloßen Hauptfigur eines Buches unterscheidet. Es ist gewiss nicht ganz
leicht anzugeben, was uns Petschorin eigentlich zeigt, denn gerade die Komplexität
dieser Aussage macht u.a. einen guten Roman aus. Mit dem Versuch, bestimmte
Schlüsselstellen in den einzelnen Episoden zu interpretieren, haben wir
Sichtweisen auf die Sinn- und Ziel(losigkeit) des individuellen Lebens, die
Bedeutung von Freundschaft, die Wahrnehmung von Liebe und Leidenschaft, die
Tragik des eigenen falschen Handelns und einige andere „Dinge des Lebens“
erhalten. Weil ich denke, dass es sich hierbei um interessante und wesentliche
Aspekte des Menschlichen handelt, halte ich Petschorin für einen Helden.
Im Gegensatz zahlreichen literaturwissenschaftlichen Deutungen,
z.B. „Lermontows Roman [ist die] psychologische Analyse,
die »Dialektik der Seele« des mit der Gesellschaft in Konflikt liegenden
Helden“(LAUER S.280), drängt sich meines Erachtens bei der Lektüre
nicht unmittelbar der Gedanke einer vordringlich intendierten Gesellschaftskritik
auf. Es mag wohl sein, dass sich die geschichtliche Verortung im Zusammenhang
mit der an Puschkin angelehnten Lyrik Lermontows (Der Held ist sein einziges
Prosawerk) so ein Bild ergibt, aber mir scheint der Held vor allem im Konflikt
mit sich selbst zu liegen und erst mittelbar mit seinem Umfeld oder gar der
ganzen Gesellschaft. Gewiss meint Lermontow mit „ein Held unserer Zeit“,
dass der Held exemplarisch für viele junge Leute seiner Zeit steht. Vielleicht
hat auch das nachträgliche Vorwort und seine Rede von dem Porträt
„, das sich aus den voll ausgereiften Lastern unserer ganzen Generation
zusammensetzt“(LERMONTOW S.12) zu der Ansicht geführt, dass
man eine solchermaßen lasterhafte Generation für nichts anderes,
als ein gesellschaftliches Problem zu halten habe. In erster Linie ist Ein Held
unserer Zeit ein Meilenstein des realistischen psychologischen Romans auf den
eine glänzende Epoche – der russische Realismus – folgte. Autoren
wie Dostojewski, Tolstoi, Turgenew u.a. perfektionierten den Roman als Charakterstudie
(z.B. Raskolnikow in Dostojewskis Schuld und Sühne, der von einem
zerrissenen Charakter schließlich noch so etwas wie ein moralischer Held
wird) und artikulieren zum Teil deutliche Gesellschaftskritik (z.B. in Dostojewskis
Die Dämonen, der Autor war selbst wegen vermeintlicher antizaristischer
Aktivitäten eine Weile nach Sibirien verbannt worden). Doch Lermontow ist
trotz seiner prominenten Nachfolger bis heute lesenswert geblieben.
Literatur
LERMONTOW, Michail „Ein Held unserer Zeit“, Inselverlag Frankfurt
a.M. 2003; das Original erschien 1840 unter dem Titel „Geroj naschego
vremeni“
LAUER, Reinhard „Der russische Realismus“ in
„Neues Handbuch der Literaturwissenschaft“ Hrsg. Klaus von See,
Athenaion-Verlag, Wiesbaden 1980