von Robert Faber
Gemeinschaft der Toten
Den Stellenwert und die Struktur einer Gemeinschaft erkennt man daran, wie
sie mit dem umgeht, was
außerhalb von ihr liegt. Wie kommuniziert sie
mit dem Außen? Welcher Platz wird dem Außen zugewiesen,
wenn es
darum geht, es zu benennen und so greifbar zu machen? Wie werden Konflikte mit
dem Außen
ausgetragen? Inwiefern wird das Außen benötigt, um
eine Gemeinschaft in ihrem Inneren zu festigen,
festzulegen und möglicherweise
sogar erst entstehen zu lassen? Es sollte dabei betrachtet werden, wie dieses
Außen konstruiert wird und welche wechselseitigen Beziehungen der Gemeinschaft
mit ihrem Außen sich dabei
herausbilden.
Wir sollten nach einer möglichst elementaren Form von Gemeinschaft suchen.
Gemeinschaft nimmt immer differenziertere Ausprägungen an, Gemeinschaften
müssen längst nicht mehr
beisammen sein, ihre Mitglieder müssen
sich nicht gegenseitig erkennen können, oft überschreiten
Gemeinschaften
die Grenzen von Nationen: Gemeinschaften der Nicknames anonymer Chat-Räume;
die
Fernsehzuschauer, die in dem Moment zur Gemeinschaft werden, wenn sie „Wetten,
daß“ einschalten; die
Gemeinschaft der individuellen Konsumprofile,
der Arbeitenden und der Essenden... Müßten wir diese
Gemeinschaften
auf eine Gemeinschaft zurückführen, so könnten wir nur etwas
Basales finden –
es handelt sich um eine Gemeinschaft der Lebenden.
Für eine Gemeinschaft der Lebenden kann
es nur ein Außen geben –
die Toten. Elias Canetti beschreibt diese Konstellation in „Masse und
Macht“ als eine Form von Doppelmasse. Die Lebenden führen einen Kampf
auf verlorenem Posten, die Armee der
Toten ist immer in der Überzahl, sie
versucht, die Lebenden auf ihre Seite zu holen. Die Toten stellen eine
konstante
Bedrohung dar, sie können in jedem Moment angreifen und die Lebenden schwächen.
Die
Gemeinschaft der Lebenden ist auf diese ungleich mächtigere Masse der
Toten angewiesen, weswegen es von enormer
Bedeutung ist, sich die Toten günstig
zu stimmen:
„Sie haben Einfluß auf die
Lebenden und können ihnen überall
schaden. Bei manchen Völkern ist die Masse der Toten ein Reservoir,
dem
die Seelen der Neugeborenen entnommen werden. Von ihnen hängt es ab, ob
die Frauen Kinder bekommen.
Manchmal fahren die Geister als Wolken daher und
bringen den Regen. Sie können einem die Pflanzen und Tiere
vorenthalten,
von denen man sich nährt. Sie können sich unter den Lebenden neue
Opfer holen. Der eigene
Tote, den man nur nach hartem Widerstand hergegeben
hat, wird schon als Angehöriger dieses gewaltigen Heeres
drüben beschwichtigt“[1]
Ob als Bedrohung oder als wohlgesonnene Geister, die Toten
werden nicht als
ein abstraktes Außen betrachtet, sondern als eine reale (Über-)Macht
mit eigenem
Willen. Die Gemeinschaft der Lebenden konstituiert sich im Hinblick
auf die Toten, richtet ihre Riten und Bräuche
nach dem Willen der Toten
ein und findet Wege zu einer beschwichtigenden Kommunikation. Zwar sind die
Massen der
Toten unsichtbar, jedoch füllen sie sämtlichen Lebensraum,
sie sind dicht beieinander, in Bewegung und wollen
gemeinsame Sache machen.
Mitten in diese Hilflosigkeit den Toten gegenüber tritt eine
Gegenbewegung
der Lebenden: Es gibt Lebende, die die Fähigkeit besitzen, den Willen der
Toten zu erkennen
und mitzuteilen – es handelt sich um Schamanen. Die
Schamanen sind es auch, die die Domestizierung der Toten
vornehmen.[2] Sie sind
nicht nur in der Lage Geister zu beschwören, sie sind darüber hinaus
in der
Lage, die Geister ihrem Willen zu unterwerfen. Die Domestizierung der
Toten ist ein Einschnitt ins Verhältnis der
beiden Parteien, ein Schritt
vom mythischen Denken zur wissenschaftlichen Zivilisation wie wir sie heute
kennen,
da die Schamanen es auf ihre Weise schaffen, die unsichtbaren Massen
sichtbar und begreifbar zu machen. Die Masse wird
somit gesprengt, da der Schamane
nie die gesamte Masse ansprechen kann, sondern aus dieser anonymen Gesamtheit
Elemente herausheben, abziehen muß - bis hin zu einzelnen Geistern mit
einer Identität (etwa den Geist eines
kürzlich Verstorbenen). Eine
Grundvoraussetzung für die Masse ist die Anonymität des Einzelnen
darin, sein vollkommenes Aufgehen in ihr als Teil des uneingeschränkt wachsenden
Ganzen. Sobald die Masse in
einzelne Bestandteile zerlegt werden kann, setzt
ihr unaufhörlicher Zerfall ein. Die einzige Möglichkeit
für sie,
diesen Zerfall abzuwenden, ist die Verwandlung. Sie muß sich in Etwas
von Dauer verwandeln
und eine feste Struktur annehmen, in deren Rahmen eine
Entwicklung, ein Werden möglich ist. Aus einer Masse
muß eine Gemeinschaft
werden.
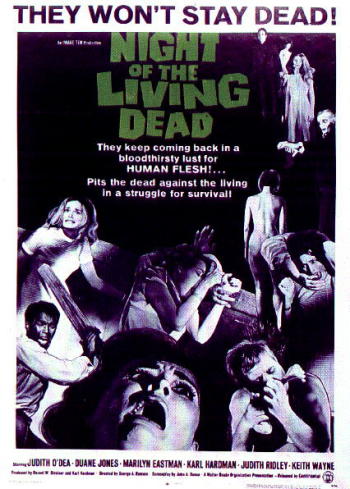
Die unsichtbare Masse, die im mythischen Denken von den Toten
gebildet wird,
verschwindet nicht, sondern wird im Verlauf des Zivilisierungsprozesses umgewandelt
und verstreut.
So erwähnt Canetti die für das Mittelalter relevanten
Massen der Teufel, denen die himmlischen Heerscharen
gegenübergestellt
werden. Zum schamanischen Hilfsmittel der wissenschaftlichen Neuzeit wurde das
Mikroskop,
welches uns zwei neue Arten unsichtbarer Massen aufzeigte –
die sich rapid vermehrenden und für die Lebenden
schädlichen Bazillen
und die Millionen von Spermateilchen, die sich, so Canetti, in größter
Dichte auf den selben Weg machen (und somit die Kriterien einer Masse erfüllen)
und die unsichtbare Masse der
Ahnen mit sich tragen.[3]
Die Fähigkeit, die Toten zu mobilisieren und für die eigenen
Zwecke
dienstbar zu machen, verändert nicht nur die Beziehung der Lebenden und
der Toten, sondern auch das
Selbstverständnis der Lebenden. Sie sind nicht
mehr den Toten ausgeliefert, sehen sich in der Lage Widerstand zu
leisten. Die
Macht der Toten wird ins Leben geholt, einverleibt. Die Toten werden er- und
begriffen. Es ist die
Entstehung des Selbstbewußtseins, die Lebenden emanzipieren
sich. Der Tod wird Teil der ökonomischen
Beziehungen. Levi-Strauss unterscheidet
in „Traurige Tropen“ zwei Arten der ökonomischen Beziehungen
mit den Toten – die Toten als Partner und als Objekt. Als Geschäftspartner
leisten die Toten Beistand
bei den Unternehmungen der Lebenden und erwarten
dafür Dankbarkeit, wollen am Gewinn partizipieren. Ganz anders
ist die
Lage bei den Toten, die als Objekte und Werkzeuge gehandelt werden:
Manche
Gesellschaften nehmen gegenüber ihren Toten eine Haltung dieses
Typus ein. Sie verweigern ihnen die Ruhe: zuweilen
im wörtlichen Sinn,
wie es wie es beim Kannibalismus und der Nekrophagie der Fall ist, wenn die
Lebenden das
Ziel verfolgen, sich die Tugenden und Kräfte des Verstorbenen
einzuverleiben; manchmal im symbolischen Sinn wie in
jenen Gesellschaften, die
von Prestigerivalitäten beherrscht sind und deren Mitglieder die Toten
ständig um Beistand bitten müssen, [...] um durch Beschwörung
der Ahnen und genealogische
Betrügereien ihre Privilegien zu rechtfertigen.[4]
Hier ist bereits die Sichtweise auf den
Tod verschoben. Der Tod wird nicht
mehr als Bedrohung von außen gesehen, sondern ausschließlich auf
seine Gebrauchsmöglichkeiten im Leben reduziert, als ein vorgeschobenes
Außen. Levi-Strauss zieht die
Schlußfolgerung:
Mehr als andere fühlen sich solche Gesellschaften beunruhigt durch die
Toten, die sie mißbrauchen. Sie stellen sich vor, daß diese ihnen
die Verfolgung heimzahlen werden
und daß sie desto anspruchsvoller und
streitsüchtiger gegenüber den Lebenden sind, je mehr diese von
ihnen
zu profitieren suchen. Doch ob es sich nun um eine gerechte Teilung handelt
wie im ersten Fall oder um eine
entfesselte Spekulation wie im zweiten, so herrscht
doch in beiden Fällen die Idee vor, daß es sich bei der
Beziehung
zwischen Toten und Lebenden nicht vermeiden läßt, zu teilen.[5]
Die
Überreste dieses Denkens lassen einen tiefen Stachel im Gewissen der
westlichen Zivilisation zurück, denn der
Bezug der Gemeinschaft der Lebenden
zum Tod veränderte sich nochmals drastisch. Konnte man sich im mythischen
Denken auf die Toten berufen oder sie für seine Zwecke benutzen, so ist
dies in der modernen Welt nahezu
unmöglich geworden. Die Metaphysik (und
somit auch der Mythos) verschwindet zwar nicht komplett aus dem Denken, so
doch
aus dem Gebrauch, der Sphäre der Ökonomie. Durch das Wegbrechen der
traditionellen metaphysischen
Instanzen offenbart sich eine veränderte
Szenerie – da es keine Transzendenz mehr gibt, muß jeder
Vorgang
empirisch wahrnehmbar auf einer Immanenzebene ablaufen. Der Tod kann nicht mehr
kollektiv erfahrbar
gemacht werden, die Toten sind als Handelspartner und -objekte
gleichermaßen ausgegrenzt, ausgeschieden. Sie sind
ihres Platzes in der
Welt beraubt, da es nur noch eine Welt ist, die den Lebenden gehört. Der
Tod ist
abgetrennt und jeder produktiven Verknüpfung mit dem Leben beraubt.
Der Tote kann nicht in eine andere Dimension
übergehen und bietet kein
Potential für ein wiedergeborenes neues Leben. Der Tod ist privat und individuell
– er ist schlicht der Punkt, an dem ein menschliches Leben verschwindet.
Anders als bei Canetti, wo die
Toten immer als eine Masse aktiv sind, ist dem
individualisierten Toten die Möglichkeit genommen, zu dieser
offenen, uneingeschränkt
wachsenden Masse dazuzustoßen. Der Tod ist kein Außen mehr, da er
aus
der Totalität des Lebens heraus betrachtet wird. Diese Totalität
des Lebens kann nach Jean Baudrillards
Theorie des unmöglichen Tausches
nicht mehr gegen ein Außen eingetauscht werden, sondern nur noch gegen
ein Double ihrer selbst. Das Außen muß sich ins Innere verschieben.
Die Toten bleiben im Leben und breiten
sich aus in der Welt der Lebenden.
Das Bild der Toten, die durch die Welt wandeln, taucht
bereits im Gilgamesch-Epos
auf, als die Göttin Ischtar droht:
Gewährst du mir aber
das Himmelstier nicht, | So zerschlag’ ich
die Türen der Unterwelt,| Zerschmeiß ich die Pfosten, lass
die Tore
weit offen stehn, | Lass ich auferstehen die Toten, dass sie fressen die Lebenden,
| Der Toten werden
mehr sein denn der Lebendigen![6]
Hier ist schon ein Mythos angelegt, der im 20. Jahrhundert vor
allem auf der
großen Leinwand eine aufsehenerregende Rückkehr feierte und Kultstatus
erreichte –
der Zombie-Mythos. Die Ursprünge findet man in den Voodoo-Religionen
der Karibik. Wikipedia klärt auf:
Dem Glauben nach kann ein Voodoo-Priester (Houngan), ein schwarzmagischer Bokor
oder eine
Priesterin (Mambo) einen Menschen mit einem Fluch belegen, worauf
dieser dann scheinbar stirbt (Scheintod). Tage
später kann er den Toten
dann wieder zum Leben erwecken. Dieser wird dann als Arbeitssklave missbraucht.
Diese Zombies nennt man auch Zombie cadavres. Sie gelten als absolut willenlos.
Eine verbreitete Idee ist, dass
dabei ein Pulver eine wichtige Rolle spielt.
Es werde gebraucht, um das Opfer in einen hirntodähnlichen Zustand zu
versetzen,
etwa vermischt mit Juckpulver auf die Haut des Opfers geblasen, das dann das
Gift in kleinen Wunden
beim Kratzen aufnimmt. Das Gift ruft schnell krankheitsähnliche
Symptome hervor, das Opfer stirbt. In dem Glauben,
dass dieser Mensch nun tot
sei, werden die Opfer begraben. Nach einer bestimmten Zeit taucht der Zauberer
am Grab
auf, wo er sein Opfer ausgräbt und ihm ein Gegenmittel verabreicht.
Dieses Mittel soll ein starkes Gift, etwa
Atropin, sein, das dem Betroffenen
bei Aufwachen seine Sinne und sein Bewusstsein raubt. Der Zombie sei dann seinem
Herren hörig und verrichtet ab sofort Schwerstarbeiten.“[7]
Es handelt sich also
eher um den zweiten Typus des von Levi-Strauss beschrieben
Handels mit den Toten, die den Toten gegenüber keinen
Respekt erweist,
sie ins Leben zurückzerrt, sie unsterblich macht, um sie ausschließlich
zum eigenen
Zweck zu benutzen. Es ist also durchaus bezeichnend, daß die
Zombies sich hauptsächlich nicht in der
Literatur ausbreiten, sondern im
Film. Prof. Tom Gunning von der University of Chicago reflektiert in der Dokumentation
„American Nightmare“ die Bedeutung des Mediums Film für die
Wahrnehmung von Leben und Tod und
folglich auch für die Entwicklung des
Horrorgenres:
„Das Kino an sich hat etwas von einem
Geisterhaus. Die Bilder selbst zeigen
nicht nur etwas, sondern sind auch in einem Bereich zwischen Realität und
Repräsentation angesiedelt. Und genau das sind auch Geister, Bilder längst
Verstorbener. Als die
Kinematographie erfunden wurde, schon bei den ersten Lumiere-Filmen
im Jahre 1895, empfand das Publikum ein Gefühl
der Unsterblichkeit. Ab
jetzt war der Tod nichts Endgültiges mehr! Denn jetzt gab es Bilder von
Menschen in
Bewegung, nicht mehr nur starre Photos. Momente des Lebens konnten
festgehalten werden. Aber dieses Versprechen der
Unsterblichkeit, brachte schlußendlich
auch „Geister“ hervor. Und so ein Geist ist nicht jemand, der
ewig
lebt, sondern jemand, dessen Gestalt und Schatten eingefangen sind. Er ist gezwungen,
dieselben Bewegungen
und Gesten immer wieder zu wiederholen, in alle Ewigkeiten
verdammt! Diese unheimlichen Gefühle sind zwar meist
unter Schichten von
Brauchtum und Vertrautheit vergraben, aber dem Horrorfilm gelingt es oft, diese
Urängste
wieder anzufachen und auftauchen zu lassen.“[8]
Gunning läßt jedoch etwas
außer Acht, da er ausschließlich
von Geistern spricht. Geister und Gespenster haben eine lange Tradition in
der
europäischen Kultur, dennoch sind Zombies nicht pauschal mit Geistern gleichzusetzen.
Die Masse der
Toten hat sich gespalten. „Zwischen Realität und Repräsentation
angesiedelt“ haben Zombies und
Gespenster gemeinsam, daß sie sich
zwischen den binären Oppositionen von Leben und Tod, Sein und Nicht-Sein
bewegen, durch den unmöglichen Tausch gezwungen, in ihrer Unfertigkeit
in der Welt der Lebenden zu bleiben,
die Lebenden heimzusuchen. Gespenster sind
Bedrohungen, die zwar heimsuchen, aber nicht erfaßt, artikuliert
werden
können. Zu Gespenstern kann nicht gesprochen werden, da sie eben eine Zwischendimension
bilden.
Außerhalb der Opposition liegend können sie nicht gedacht
werden, da das vorherrschende Denken im
binären Code traditionell darauf
bedacht ist, die Realität von den Trugbildern zu säubern. In
„Marx’
Gespenster“ spielt Jacques Derrida mit der Mehrdeutigkeit des Wortes „Geist“
und der Verbindung zwischen „Geist“ und „Gespenst“,
aber auch ihrer Differenz. Zunächst
ist es der Geist der Geschichte des
Denkens – die großen Geister der Geschichte. Diese rufen jedoch
die ausgegrenzten Geister hervor, die diese Geschichte heimsuchen und Fragen
stellen. Im Ungeformten dieser Fragen, in
ihrer Unkenntlichkeit und der Ignoranz
der Geistesgeschichte sogenannten Trugbildern gegenüber, suchen sich die
ausgegrenzten Geister eine Verkörperlichung und werden zu Gespenstern:
„Sobald
man den Geist nicht mehr vom Gespenst unterscheidet, verkörpert,
inkarniert er sich, als Geist, im Gespenst. Oder
vielmehr ist das Gespenst [...]
eine paradoxe Verleiblichung, ein Leib-Werden, eine bestimmte leibliche
Erscheinungsform
des Geistes. Er wird vielmehr zu einem „etwas“, das schwer zu benennen
bleibt: weder
Seele noch Leib, und doch beides zugleich. Denn der Leib und die
Phänomenalität sind das, was dem Geist seine
gespenstische Erscheinung
verleiht, doch sogleich in der Erscheinung verschwindet, im Kommen selbst des
Wiedergängers oder der Wiederkehr des Gespenstes. Es gibt Entschwundenes
(disparu) in der Erscheinung (apparition)
als dem Wiedererscheinen des Entschwundenen
selbst. Der Geist und das Gespenst sind nicht dasselbe und wir werden diese
Differenz verschärfen müssen, aber was das angeht, was sie gemeinsam
haben, so weiß man nicht,
was das ist, was das gegenwärtig ist. Es
ist nämlich etwas, was man nicht weiß, und man weiß
nicht,
ob das eigentlich ist, ob das existiert, ob es auf einen Namen hört (répond)
und ihm ein Wesen
entspricht (correspond). Man weiß es nicht – aber
nicht aus Unwissenheit, sondern weil dieser
Nicht-Gegenstand, dieses Anwesende
ohne Anwesenheit, dieses Dasein eines Anwesenden oder eines Entschwundenen nicht
mehr dem Wissen untersteht. Jedenfalls nicht mehr dem, was man unter dem Namen
des Wissens zu wissen glaubt. Man
weiß nicht, ob es lebendig ist oder
tot.“[9]
Geister beziehungsweise Gespenster
sind also ein raumloser Fluch, der nach
einer Verkörperlichung sucht. Das trifft auf die Zombies des 20.
Jahrhunderts
nicht zu. Um zu begreifen was Zombies ausmacht, bedienen wir uns der Filme George
A. Romeros,
insbesondere seines aktuellen Films „Land of the dead“.
Der Zombie verfügt über keinerlei
Geistigkeit, er ist rein körperlich.
Wie wir es schon dem Mythos entnehmen können, ist es die Schuld von
Lebenden,
daß er es nicht geschafft hat, die Seiten zu wechseln. Es gibt für
ihn keinen Übergang,
keine Alternative zum physischen Leben; zwar ist er
von der kontrollierenden Instanz dessen, was man im allgemeinen
Sprachgebrauch
als „gesunden Menschenverstand“ bezeichnet, befreit, so ist er nur
noch reines
Begehren. Die Zombies klammern sich am physischen Leben fest und
müssen sich lebendes Gewebe einverleiben, um
ihren Fortbestand zu sichern.
Die Toten holen sich also noch immer die Lebenden und sind immer noch in der
Überzahl. Während Gespenster in ihrer Raumlosigkeit isoliert auftreten,
bilden die Zombies immer eine Masse.
Der Unterschied besteht ausschließlich
in der Würdelosigkeit des Todes – die Toten holen nicht mehr
die
Lebenden zu sich hinüber, vielmehr müssen sie als ein Double des Lebenden,
eine Imitation des
Menschen umhertorkeln, lächerlich, wie jedes Ergebnis
einer in der Mitte steckengebliebenen Verwandlung, in der
Lächerlichkeit
der blanken Wut jedoch nicht weniger gefährlich. Der Zombie ist eine Bedrohung,
die
keine besondere geistige Anstrengung erfordert, er ist eine dem Bewußtsein
des Massenmedienzeitalters
angepaßte Bedrohung. Es gibt kein Ritual zur
Besänftigung eines Zombies – ganz im Gegensatz zum
Gespenst, welches
die Beschäftigung eines Geistes mit ihm einfordert, der genealogisch die
Herkunft des
Fluches herausarbeiten, die Stelle erkennen soll, an der Unrecht
geschah. Die Gemeinschaft der Toten paßt sich
dem Standard der Lebenden
an um nicht zu verhungern. Auch spielt die von Gunning angesprochene Unsterblichkeit
und Gefangenschaft der Toten im Medium Film eine große Rolle: Die in „Dawn
of the dead“ von Tom
Savini (in „Dawn of the dead“ insbesondere
für Make-up und Special Effects verantwortlich ) gespielte
Figur des Biker-Anführers
entkommt dem von Savini miterschaffenen Mythos nicht und muß in „Land
of the dead“ als Zombie zurückkehren und sein Markenzeichen mitbringen
– die Machete.
Bei Romero wird die Herkunft der Zombies nie geklärt, nur ein vages Schuldbewußtsein
der
(Über-)Lebenden wird gelegentlich artikuliert.[10] Die Zombies sind
Produkte der Menschen, wie schon im
Originalmythos. In „Night of the living
dead“ wird im Fernsehen von einem Satelliten berichtet, der zur
Venus
geschickt wurde, mit einer seltsamen Strahlung zurückkam und von der NASA
abgeschossen werden
mußte. Wenn man bedenkt, daß der Film vor der
Mondlandung gedreht wurde, kann man diese
„Information“ nur mit
einem Schmunzeln versehen – auf der einen Seite aufgrund des Seitenhiebs
auf den damals vorherrschenden amerikanischen kosmischen Größenwahn,
auf der anderen Seite, weil
ironischerweise auffällt, daß der CIA
und das FBI keine Stellungnahme abgeben wollen, was die Venus-Version
nicht
glaubwürdiger macht. Es wird allenfalls klar, daß sie nur durch die
Waffen derer
unschädlich gemacht werden können, die sie erschufen.
So glänzt der Anführer der Redneckmiliz in
„Night of the living
dead“ durch sein fundiertes Fachwissen in Punkto Zombieproblematik und
klärt die Fernsehzuschauer auf, daß die dummen Kreaturen durch einen
Kopfschuß zu erledigen seien. Der
geballten wissenschaftlichen Ahnungslosigkeit
der Fernsehexperten, die von einer „epidemy of mass homicide“
sprechen
und den Zuschauer darüber aufklären, daß die geheimnisvolle
Strahlung bei den Leichen
Hirnaktivitäten auslöse („kill the
brain and you will kill the ghoul“ lautet die massentauglich
formulierte
Lösung), stellt Romero eine Begründung aus halbvergessenen mythischem
Wissen: Peter, die
schwarze Hauptfigur aus „Dawn of the dead“, zitiert
die prophetische Warnung seines Großvaters, der
Priester auf Trinidad
war, wo sich das Christentum mit Macoumba-Voodoo vermischte: „When there
is no more
room in hell, the dead will walk the earth.“. In „Land
of the dead“ wird die Herkunft der Zombies
nicht mehr begründet.
Die menschliche Schuld ist vergessen, es scheint, als wären die Zombies
schon
immer ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens gewesen.
Romero schafft es, dem Zombiemythos
mehrere amerikanische Mythen der jeweiligen
Zeit entgegenzustellen – in „Night of the living dead“
etwa
die Nachrichten, die den Bürger mit frischen und objektiven Informationen
versorgen,[11] den Kosmos mit
seinen unbekannten fremdartigen Gefahren und Waffen,
mit denen man allen Gefahren trotzen kann. Mit jedem Film reagiert
Romero auf
eine veränderte gesellschaftliche Situation und verändert die Funktion
seiner Toten. Um die
Veränderungen zu erkennen, werfen wir einen Blick
auf zwei der wichtigsten Serien, die sich durch Romeros Filme
ziehen:
Bedürfnis nach Sicherheit und Orte, die Sicherheit versprechen
Ist es in „Night of the living dead“ ein altes Haus, wo sich der
Keller im Endeffekt und
langem Konflikt als der einzige sichere Ort erweist,
ist es in „Dawn of the dead“ ein Einkaufsparadies,
welches ein Leben
in Sicherheit und Wohlstand verspricht, so wird in „Land of the dead“
ein doppelter
Ring der Sicherheit aufgebaut. Zum einem gleicht die Stadt einer
Hochsicherheitsfestung mit Stacheldraht und elektrisch
geladenen Zäunen,
zum anderen wird die Stadt aus einem Wolkenkratzer regiert, der in der Mitte
der Stadt
steht und wo die Reichen hinter Panzerglas ihr gewohntes Luxusleben
weiterführen – das Fiddler’s
Green. Die Gemeinschaft der Lebenden
wird von zwei Dingen zusammengehalten – der Angst angesichts der Tatsache,
daß die Zombies sich mittlerweile im ganzen Land ausgebreitet haben, und
einem Traum, der in der Stadt
verbreitet wird, dem Traum vom sozialem Aufstieg
und den damit verbundenen Einzug ins Fiddler’s Green.[12] Eine
nur vorgeschobene
Möglichkeit, da die Reichen unter sich bleiben wollen und keinen sozialen
Aufstieg
zulassen, was auch den Konflikt des Films auslöst. Romero vertauscht
die Rollen der Toten und der Lebenden. Die
Zombies stellen zwar noch gewohnheitsmäßig
eine Bedrohung dar, faktisch aber kommen sie kaum noch in die
Nähe der
Stadt. Während die Gewalt der Lebenden sich in den alten Filmen damit rechtfertigt,
daß
sie sich vor den Toten schützen müssen, sind die Lebenden
nun eindeutig die Aggressoren, denen ihre Umgebung
zu eng ist und die ihre imperialistischen
Gewohnheiten fortführen. Mit einem stärkeren Bedürfnis nach
Sicherheit
denn je. Eine paradoxe Wechselwirkung – je weniger bedrohlich und aggressiv
die Zombies
vorgehen, desto ausgefeilter werden die Sicherheitsvorkehrungen
der Lebenden. Die Jägereinheit fährt mit dem
gepanzerten und mit modernsten
Waffen ausgestatteten Truck „Dead Reckoning“ in die Siedlungen,
wo
sich Zombies niedergelassen haben, sie schießen Feuerwerke in den Himmel,
die Zombies starren gebannt nach oben
und werden der Reihe nach erschossen.
Bewusstsein, Erinnerung und Persönlichkeit
Romero bringt die Toten und Lebenden einander näher, er verwischt die
Differenzen immer mehr. So
heißt es in einem Dialog von „Land of
the dead“: „They’re pretending to be alive.“
–
„Isn’t it what we’re doing? Pretending to be alive?”
Sind die Supermarkt-Zombies
aus „Dawn of the dead” den konsumfreudigen
Lebenden in ihrem Begehren durchaus nicht unähnlich, so
läßt
Romero in „Land of the dead“ seine Zombies sich weiterentwickeln
und lernen. Gleich
zu Beginn des Filmes werden wir Zeugen einer kuriosen Zombieversammlung,
auf der die Zombies sich allesamt an ihre
früheren Berufe zu erinnern scheinen.
So gibt es eine groteske Kapelle von Musikantenzombies (deren Musik man,
wenn
man euphemistisch ist, als disharmonisch bezeichnen könnte) und einen Tankwartzombie
– den
schwarzen „Big Daddy“, der im Verlauf des Films zum
Anführer der Zombies wird, da er in seiner
Entwicklung schnell Fortschritte
erzielt. Damit wird die Linie des Erinnerungsvermögens aus „Dawn
of
the dead“ fortgeführt, wo die Zombies sich daran erinnern, daß
das Einkaufszentrum eine wichtige
Funktion in ihrem Leben hatte. In „Land
of the dead“ werden die Zombies mehr als nur Kanonenfutter, sie
bekommen
eine Identität. Im Verlauf des Films entwickeln sie nicht nur ein individuelles,
sondern auch ein
kollektives Bewußtsein, man könnte sogar von einem
Klassenbewußtsein sprechen. Dabei sind mehrere
Faktoren von Bedeutung.
Zunächst ist da die Ästhetik der „Feuerblumen im Himmel“:
Die
Feuerwerke erinnern die Zombies an einen Himmel, an das Versprechen von
Unsterblichkeit, eine Transzendenz, derer sie
beraubt wurden. Nach der ästhetischen
Dimension kommt die politische Dimension hinzu: Die Zombies erkennen ihre
Widersacher
und bewegen sich Richtung Stadt, sind intelligent genug, die Struktur der Stadt
zu durchschauen und
sie über die ungeschützte Seite (den Fluß)
zu betreten. Sie überwinden dabei ihre Scheu vor dem
Wasser, lernen unterwegs
den Umgang mit Waffen, lassen sich nicht mehr von den „Feuerblumen“
ablenken, als sie sich durch die Menschenmenge fressen und brechen ins Fiddler’s
Green ein, wo „Big
Daddy“ (der Anführer der Toten) Kaufmans
(der Herrscher der Stadt mit unverkennbarer Donald
Rumsfeld-Attitüde) Auto
volltankt und dann mitsamt Kaufman explodieren läßt. Der Zaun, den
die
Menschen zu ihrem Schutz erbaut haben, ist der gleiche Zaun, der sie daran
hindert, aus der Stadt zu fliehen, als der
Feind eingedrungen ist.
Während also die Toten menschliche Züge erlernen, verlernen die
Menschen
ihre Menschlichkeit. Sie zeigen keinen Sinn für Ästhetik und haben
keinerlei Visionen
außerhalb von Reichtum und persönlicher Sicherheit,
ihre Gemeinschaft bekommt Risse beim ersten offenen
Konflikt, als der Traum
nicht erfüllt wird. Einer der Anführer der Dead Reckoning-Crew wird
nicht im
Fiddler’s Green aufgenommen und wendet sich gegen Kaufman, indem
er die Superwaffe entführt und ihm droht,
Raketen auf den Wolkenkratzer
abzufeuern, wenn er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht einen hohen Geldbetrag
bekomme. Die Lebenden verfügen im Gegensatz zu den Toten über keinerlei
Lernfähigkeit – selbst in
einer Welt, wo Tote umherwandeln, verfügt
Geld noch immer über einen Wert und ist das Einzige, was diese Art
von
Gemeinschaft notdürftig zusammenhält – die Gemeinschaft der
Lebenden funktioniert, indem sie
eigentlich nicht funktioniert, da es Selektion
und Ausgrenzung gibt. Romero gibt die Lebenden auf. Während die
Zombies
an Profil gewinnen, bleiben die lebenden Charaktere blaß. Die Zuschauer
erfahren kaum etwas
über ihre Vergangenheit – Riley, einer der Hauptcharaktere
sagt von sich, er hätte in seinem Leben
nichts Schlimmes erlebt und würde
keine Background Stories mögen. Die Charaktere bauen keine persönliche
Beziehung auf, da sie größtenteils in ihren jeweiligen Klischees
und Catchphrases kommunizieren. Sie
sind nicht mehr als ein Gimmick, haben nicht
einmal volle Namen.
Die Verlagerung des
Schwerpunkts zugunsten der Toten äußert sich
auch in der Serie des schwarzen Protagonisten, welcher bei
Romero auch die klassische
Bedeutung des Wortes besitzt – der Ersthandelnde. Sowohl in „Night
of the
living dead“ als auch in „Dawn of the dead“ ist der
Schwarze derjenige, der handelt, Ideen hat und
die Führung übernimmt.
In „Land of the dead“ ist der Protagonist eben „Big Daddy“
– er versucht, seine Mitzombies aus der Schußlinie zu ziehen, mobilisiert
sie zum Aufstand, er bringt
den Anderen etwas bei, seine Führerposition
ist also auf besonderen Fähigkeiten aufgebaut, während
Kaufman sich
auf Angst, Ausweglosigkeit und Manipulation stützt. Eine Gemeinschaft,
die nicht ein Werden
fördert, sondern nur den gegebenen Zustand stützt
und somit nur den eigenen Zerfall verzögert, hat keine
Zukunft. Romero
traut den Lebenden nicht zu, die Verhältnisse, in denen sie leben, zu hinterfragen
und zu
verändern. Die Revolution muß von den Toten ausgehen. Es sind
die Toten, die in die Ökonomie
einbrechen, die Welt des Luxus heimsuchen,
ihr Recht einfordern und daran erinnern, daß es notwendig wäre,
mit
ihnen zu teilen. Während die Toten auf dem Weg sind, aus einer Masse eine
Gemeinschaft herauszubilden
und eine neue Form der Existenz zu erreichen, läßt
Romero den Überlebenden die Möglichkeit, an
alter Stätte eine
neue Gemeinschaft aufzubauen. Am Ende des Films geschieht zum ersten Mal eine
Begegnung
der Lebenden und der Toten auf Augenhöhe, Riley und „Big
Daddy“ haben Augenkontakt und scheinen sich
zu verstehen. Riley verzichtet
darauf ihn zu eliminieren und auch Big Daddy greift nicht an, sondern dreht
sich
um. Sie entdecken Gemeinsamkeiten, beide suchen nach einem Ort, an dem
sie sein können. Romero sieht die
Möglichkeit einer Änderung
der Gemeinschaftsform der Lebenden wohlwollend, aber skeptisch. Er läßt
den Protagonisten auf der Seite der Lebenden einen Neuanfang an einem anderen
Ort starten – in
Kanada.
Anmerkungen
[1] CANNETTI, S. 76-77.
[2] Es wäre höchst spekulativ, diese
Entwicklung in einen linearen
historischen Ablauf einzuordnen. Man kann wohl davon ausgehen, dass das Sich-Herausbilden
von Schamanen, welches in jede Kultur Einzug hielt, nicht vom allgemeinen Entstehen
von sozialen Strukturen zu
trennen sei. Die Domestizierung der Toten können
wir uns also eher als eine Schicht vorstellen, die mit der
Hilflosigkeit den
Toten gegenüber ko-existiert, bei wechselseitiger Wirkung.
[3]
Vgl. CANETTI, S. 51 ff.
[4] LEVI-STRAUSS, S. 233.
[5]
Ebd.
[6] GILGAMESCH, S. 56.
[7]
http://de.wikipedia.org/wiki/Zombie, zuletzt eingesehen am 2.12.2005, 1:53.
[8] The American
Nightmare, Epix Media AG 2005.
[9] DERRIDA, S. 19 f.
[10]
Diese mysteriöse Herkunft zog eine Reihe von Parodien nach sich, so
in einer „South Park“-Episode, wo
die Zombies durch versehentliches
Einbalsamieren der Leichen mit Worchester-Sauce entstehen.
[11] Dieser Mythos wird zu Beginn von „Dawn of the dead“ entlarvt,
als der Producer
zugibt, seit zwölf Stunden alte Informationen über
Zufluchtsstationen zu senden
[12] Romero benutzt sogar als Stilmittel die Werbung im Film – einen Werbespot
für das
Fiddler’s Green. Interessant ist die Serie der bewegten Bilder,
der Fernseher in Romeros Filmen. Ist der
Fernseher in „Night of the living
dead“ noch wichtig, um Informationen zu bekommen, erlebt man in
„Dawn
of the dead“ den Abgesang auf das Fernsehen, als man sieht, wie eine Fernsehstation
im Chaos
versinkt, veraltete Informationen sendet und dann den Sendebetrieb
einstellt, so erfüllen die Fernseher in
„Land of the dead“
nur noch die Funktion Werbung auszustrahlen.
Literatur
CANETTI, Elias: Masse und Macht. Frankfurt a.
Main.
LEVI-STRAUSS, Claude: Traurige Tropen. Frankfurt a. Main 1978.
[GILGAMESCH]: SCHOTT, Albert Schott / SODEN, Wolfram v.: Das Gilgameh-Epos.
Stuttgart
1958.
DERRIDA, Jacques: Marx Gespenster. Frankfurt a. Main 2003.