von Konstanze Schwarzwald
Über Lebenskünstlertum - mit Nietzsche und über ihn
hinaus
Ein „Lebenskünstler“ und der von
ihm abgeleitete Begriff der „Lebenskunst“ wird im allgemeinen
Sprachgebrauch meist mit
einer Art cleverem Müßiggang,
der alles überlebensnotwendige in letzter Minute gerade noch
irgendwie zu bewältigen weiß, verstanden, als jemand,
der es eben versteht,
sich so oder so durchs Leben zu schlagen.
Als ewig schwankender Traumtänzer, als
Vorwärtsstolpernder,
der sich nach dem Eintritt eines Ereignisses ungläubig zurückdreht,
die Gefahr erkennt und nun erleichtert ist, „Glück gehabt“
zu haben.
Dies soll an dieser Stelle nicht gemeint sein!
Die Frage, was
„Lebenskünstlertum“ für den
einzelnen meinen kann, stellt sich ernsthaft nur dem, den
der werdende
Inhalt im Prozeß der Antwortsuche nicht überfordert und
den er
damit selbst existenziell betrifft.
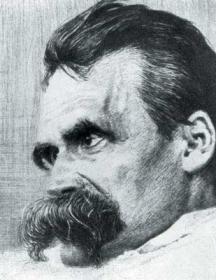
Im nietzscheanischen Sinne ist der Begriff der Lebenskunst im Zusammenhang
mit seinem
Gedanken des „Willens zur Macht“ und seiner
Konzeption des „Übermenschen“ zu
verstehen. Es
gibt zwei Stilmittel, die das Leben des Künstlers aus sich
heraus
begründen: das Apollinische und das Dionysische, verkörpert
in Apollon, dem Gott der
Maßgebung und Dionysos, dem Gott
des Rausches.
Das
Apollinische impliziert die „Kunst des
Bildners“ das Dionysische die „unbildliche Kunst,
die
Musik“. Es sind die zwei Urtriebe der Kunst, die in den „getrennten
Kunstwelten des Traumes und des Rausches“ das „ebenso
dionysische und apollinische Kunstwerk
der attischen Tragödie
erzeugen“.[1] Die künstlerische Welt
des Traumes
ist die des „schönen Scheins“, des
Stilvollen und Harmonischen als maßgebende
Komponente, die
das Rauschvolle, Orgiastische – die überschäumende
Welt
der Phantasie und Lust, den dionysischen Trieb, zügelnd
beherrscht. Das Dionysische ist das
Ursprünglichere, wobei
beide nicht voneinander zu trennen sind – eines existiert
nicht ohne das andere. Das Dionysische wäre der Welt nicht
zugänglich ohne das Apollinische und
das Apollinische wäre
gehalt- und wesenlos ohne das Dionysische.
„Damit es Kunst giebt, damit es irgend ein
ästhetisches Thun und Schauen giebt,
dazu ist eine physiologische
Vorbedingung unumgänglich: der Rausch.“ [2]
Der
Rausch, der den Künstler lebensleitend erfaßt ist
also sowohl apollinischer als auch
dionysischer Rausch als einerseits
vermittelt-kontrollierter und andererseits unmittelbar-affektiver
Rausch. Eben diese beiden Triebe gegeneinander abwägend zu
beherrschen, ihnen damit die
Möglichkeit gebend, sich zu ergänzen
und zu vervollkommnen, ist des Künstlers Leben. Er
begreift
das Leben als Objekt seines künstlerischen Selbst und transzendiert
es
damit zum selbstbestimmten Werk.
Der Leib des Künstlers ist eine
„große Vernunft̶,
indem er mit eben den beiden Urtrieben seiner Natur umzugehen
weiß,
indem er damit seine Fähigkeiten experimentell und risiokobereit
zu
nutzen versteht und in jedem Moment erweitern kann, als Grenzgang,
als selbstbestimmte immanente
Transzendenz seiner künstlerischen
Macht.
In diesem Sinne ist
Lebenskunst Extremismus, Grenzgang,
Abgründigkeit, Experiment, als ein erst einmal individuelles
Lebenskonzept. Nietzsches Hoffnung ruhte auf den „kommenden
Philosophen“, den
„Philosophen der Zukunft“, die
nicht an seinem individuellen Konzept, das hier nur der Beginn
einer
Neuordnung sein kann, hängen bleiben, sondern über ihn
hinaus denken und
damit über eine neue Form der Gemeinschaft.
Eine Gemeinschaft, in der „Übermenschen“
[3]
als Elite die Führung haben, in einer transdemokratisch-hierarchischen
Form,
welche sich nicht nach Stand und Blut ordnet, sondern nach
den Fähigkeiten der einzelnen. Eine
Gemeinschaftsform, die
im praktischen Vollzug die Inhalte ihrer Insassen flexibel zuläßt,
sie nicht dogmatisiert, sondern in ihre werdende Bewegung einschließt,
die sie zwar lenkt,
aber nicht theoretisch einschränkt. Soweit
dies als Ausblick.
Aber schon im nietzscheanisch-individuellen Sinne bedeutet „Lebenskunst“
immer
mehr als eine Theorie zu erstellen, jede Theorie kann als
solche nur Totgeburt sein, weil sie ein
Erreichen, einen Endpunkt
suggeriert. Als dogmatische Anleitung hat sie nämlich keinen
Wert und wäre eben nicht im Sinne wirklicher Lebenskunst, weil
man nicht Lebenskünstler werden
kann, wie man etwas wird, wenn
man für den entsprechenden Kurs an der Volkshochschule ein
Zertifikat bekommen hat. Es geht im Gegensatz dazu um Selbstbildung,
um Ergreifung
selbstgewählter Möglichkeiten im Kontrast
zu den allgemeinen Vorgaben, die dem einzelnen ein mehr
oder weniger
„glückliches Leben“ garantieren wollen.
Zur Lebenskunst gehört also der Mut zum Sprung in die eigene
Abgründigkeit, der
Wille zum aktiven Wahnsinn, zur Verrücktheit
im Kontrast zu einer Welt, deren Rezepte nur noch
Passivität
verschreiben. „Wille zur Macht“ und „Übermensch“
ist bei Nietzsche vielmehr als Weg- bzw. Richtungsweiser, nicht
aber als End- oder Zielpunkt zu
verstehen.
Der Begriff des „Tanzes“ ist also doch nicht falsch,
wenn man von selbstbestimmtem Lebenskünstlertum spricht, wenn
man den ewigen Seiltanz des
Lebens zwischen dionysisch-rauschvoll
erlebter Existenz und maßvoller Apollinik, von der Welt der
innigsten Lebenssehnsüchte, und der Welt, die diese zu stilisieren
sucht,
spricht.
In diesem Sinne ist der „Traumtänzer“, der seine
Tanzschritte von Moment zu Moment weiter stilisiert, Rausch-und
Lebenskünstler und hat als
einziger die Chance, mit Nietzsche
und über ihn hinaus, tanzende Sterne zu gebären.
Anmerkungen
[1] Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem geiste der Musik. KSA 1, 26
[2]Friedrich Nietzsche, Götzendämmerung. KSA 6, 116
[3]„Übermenschen“ meint Menschen,
die fähig sind in jeder
Situation über ihr „Menschlich-Allzumenschliches“
hinauszugehen, das ewig
Menschliche in sich stets zu transzendieren,
es zu überwinden, um einer höheren Aufgabe
willen,um
einer Gemeinschaft willen. Das allein befähigt sie,andere
zu
führen.