von Michael
Wehren
Asoziale Postmoderne? Ein paar Gedankensplitter
“This is not a science-fiction novel.
Or maybe it is. I don’t
care if you don’t.”
Richard Meltzer
I
„Jeder geschlossene Raum ist ein
Sarg.“
- Blumfeld
Er hat ein
Problem. Zumindest sieht er eins. So
geht das nicht, aber anders muss es gehen. Sein Name ist Richard
Rorty, er nennt sich selbst einen Liberalen. Er mag Leute, die
er „ironistische
Intellektuelle“ nennt, aber er sieht
da, wie bereits oben erwähnt, auch ein Problem. Liberaler
zu sein – das bedeutet für ihn, eine politische Haltung
einzunehmen welche
„ja“ sagt zum Modell dessen, was
wir als „westliche Demokratie“ bezeichnen. Sie
wird
von ihm als beste Chance angesehen, „Solidarität“
zu
fördern und zu verwirklichen. Ironie wiederum bezeichnet
aus seiner Perspektive eine Denkrichtung
der es primär um
„Autonomie“ in beinahe allen denkbaren Formen geht.
Diese Linie führt laut Rorty von Nietzsche und Hegel bis
hin zu Foucault und Derrida. Doch leider
wollen sich diese sogenannten
Denker in ihren Autonomiebemühungen nur recht selten auf
ihre Privatsphäre beschränken – High Noon. Das
Problem ist „dass das Streben
nach Autonomie sich nicht
mit Solidaritätsregungen verträgt.“ [1]
Und
als es anders scheinbar nicht mehr geht, sagt er: trennen
wir doch. Das konnten Philosophen schon immer
gut – im Zweifelsfall
differenzieren und vereinfachen. Die hohe Kunst der analytischen
Amputation.

Richard Rorty
II
„Der Mensch des Supermarktes kann organisch
gesehen nicht der Mensch eines einzigen Willens, eines einzigen
Verlangens
sein.“ – sagt Michel Houellebecq, da antwortet
Gilles Deleuze Jahre zuvor: „Aber da
jeder andere auch,
schon mehrere ist, kommen da nicht wenige zusammen.“
Durch die Problematisierung der Praktiken des Wirklichen
(also zum Beispiel
des Wissens), dem Insistieren auf ihre Performativität,
wird ein Handlungsspielraum eröffnet.
In diesem „müssen
[wir] uns das, was wir sein könnten, ausdenken und aufbauen“
[2]. Diese Kritikkonzeption, die ich
hier am Beispiel Foucault exemplarisch
vorgeführt habe, entwirft
Theorie als Teil lebensweltlicher Praxis, in dem Sinne, dass sie
gesellschaftliche Identitäten reformulieren, ausbauen und
umformen hilft. Sie schreibt
nicht vor, sondern stellt aus, exponiert
Gedanken. Anstelle des Wahnsinns, der Kranken, des Philosophen
– tritt eine Polyphonie der Identitäten. Die Kritik
als Neudeutung und
Neubeschreibung der eigenen Zeit, des eigenen
Geworden-seins, der eigenen Identität –
erzählt
und transformiert (potentiell) dadurch. Erzählen, als „weben“.
An diesem Punkte setzt die Kritik Richard Rortys an. Das Theorieverständnis
von Foucault
reiht er ein in die Gruppe solcher Denker, die er
als ironische Intellektuelle bezeichnet. Deren
Bemühungen
um Autonomie stehen für ihn im Kontext von Ent-Solidarisierung
und dem Verlust kollektiver Werte. Mit Habermas sieht er durch
Denker wie diese den demokratischen und
liberalen Grundkonsens
gefährdet. Die Situation stellt sich als potentielles Dilemma
dar, doch ist Rorty in der Lage beide Ansprüche zu retten
- mittels einer strengen Trennung in
den Bereich des Öffentlichen
und den Bereich des Privaten. „Ironistische Theoretiker
wie Hegel, Nietzsche, Derrida und Foucault scheinen mir von unschätzbarem
Wert für
unsere Versuche, uns ein privates Selbstbild zu
machen, aber reichlich nutzlos, wenn es um Politik
geht.“
[3] Theorie wird dabei privatisiert,
Mittel der eigenen Vervollkommnung
– abgetrennt von der
liberalen Sphäre der Öffentlichkeit. Diese wiederum
will er nicht auf eine fundamentale Konzeption wie zum Beispiel
Habermas’ Universalpragmatismus
stützen, sondern auf
Solidarität. “Die liberale Ironikerin möchte nur,
dass unsere Chancen, freundlich zu sein und die Demütigung
anderer zu vermeiden, durch
Neubeschreibung erhöht werden.“
[4] Mittel zur Realisierung liberaler
Werte wird dabei die Kunst im weitesten Sinne. Es findet also
eine Vertauschung statt – Theorie
wird privat, Fiktion wird
öffentlich.
Theorie bezeichnet Rorty hier als in seinen Augen sinnloses Bemühen,
das menschliche
Miteinander humaner zu gestalten.
III
„Ich suche in den Räumen Ähnliches,
wobei mich anzieht, wie verschieden
ähnliches ist.“
Candida Höfer
Die
Trennung zwischen öffentlich und privat
konstituiert in Rortys Diskurs die Sphäre des
Öffentlichen
als autarke und vollendete. Sie besitzt sogar ein eigenes Gesetz,
dass der Solidarität. Um diese verwirklichen zu können,
muss die Identität als Liberaler
gesichert sein. Gesichert
auf der Ebene des Politischen – nicht auf der Ebene des
Privaten. Dabei ist eben dieses Politische in Rortys Augen primär
poetisch, nicht theoretisch. Die
Frage nach der Identität
des Subjekts im Bereich des Politischen scheint die Gefahr der
Asozialität, also der fehlenden Solidarität herauf zu
beschwören. Es gilt nun
folgende Punkte kritisch zu hinterfragen:
a) Berechtigung der Trennung in öffentlich und privat b)
die Trennung in Theorie und Fiktion. Grundlage der ersten Differenzierung
ist eine
Vorstellung von Öffentlichkeit, ist eine Vorstellung
des Politischen, welche diese vom Alltag,
besser gesagt dem Privatleben
der Menschen abtrennt. Wir leben sozusagen in zwei Sphären,
die jeweils eine eigene Logik besitzen. Dagegen lässt sich
eine Theorie des Politischen
entwerfen in der das „Politische[...]
das in jedem Lebenszusammenhang versteckt ist“ [5]
die Perspektive darstellt. In solch einem Kontext ist das Politische
als ein sozialer
Produktionsprozeß, eben auf die Ebene des
konkreten, persönlichen Lebenszusammenhanges
angewiesen.
„Der arbeitsteilig entwickelte Sachbereich Politik umfasst
nur
einen Teil des Politischen, andere Teile grenzt er notwendig
aus.“ [6] Anzumerken bleibt dabei:
Rortys Position schließt eine solche Ebene des zwischenmenschlichen
Zusammenhanges (im Gegensatz zur sozialen, moralischen Abstraktion)
nicht zwangsläufig aus –
um so fragwürdiger sind
die von ihm gezogenen Konsequenzen. Denn gerade in der Sphäre
des Politischen geht es ja um Solidarität. Diese ist allerdings
auch notwendig an die
Sphäre des eigenen Lebens, der eigenen
Identität, gebunden. Letztlich handelt es sich bei
Rortys
Differenzierung um eine zweideutige Wiederaufnahme der Definition
der
traditionellen Öffentlichkeit „deren charakteristische
Schwäche auf dem
Ausgrenzungsmechanismus zwischen öffentlich
und privat beruht“ [7]. Von einer
solchen Warte aus betrachtet ist der Öffentlichkeitsbegriff
Rortys zusammenhanglos – die
Solidaritätsregungen des
Liberalen sind abstrakt, zumindest wenn Rortys Differenzierung
zutrifft.
Die zweite Unterscheidung – die in Theorie
und Fiktion scheint noch problematischer. Denn Foucaults genealogisch-kritisches
Unternehmen
setzt z.B. gerade dort ein wo sich Theorie und Fiktion
treffen. Er poetisiert die Kritik – macht
sie zur Theoriefiktion
[8] – wie Lyotard diese Gattung
nennt. Damit ist aber
genau der Schnittpunkt zwischen öffentlich
und privat betroffen, in dem eine Kritik, die den
normativ-prüfenden
Standpunkt verlassen hat, sich verorten lässt. Ist die „alte“
Dimension die folgende: „Die Kritik ist eine wesentliche
Dimension der
Repräsentation: sie ist in der Ordnung des
Theatralischen das, was sich „raushält“,
das
Äußere“ – so stellen die Formen der Kritik,
denen unsere
Aufmerksamkeit momentan gilt, genau das Gegenteil
dar: sie beziehen sich nicht auf dieses Zentrum, sind
Teil einer
Analyse die „nicht [glaubt] [...] dass das Gesetz oder die
zentrale
Macht miteinander verwachsen sind, sie sagen ja zu einem
anderen Raum [...] einem Patchwork“ [9]
. Hier lässt sich die Perspektive von Rortys Kritik finden:
Foucault und andere
liefern Konzepte mit denen Minderheiten und
einzelne Gruppen in den Fokus treten – im Bereich des
Öffentlichen.
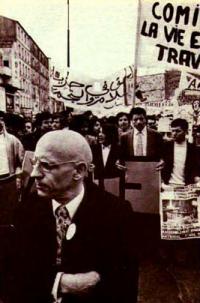
Foucault und die
"Öffentlichkeit"
Lyotard und Foucault formulieren eine Kritik
die
nicht richtend, also prüfend ist, sondern relativierend und
konstruktiv.
Weniger geht es ihnen darum den Bereich der Legitimität
zu hegen, sondern viel eher darum diesen
auszuweiten, Alternativen
aufzuzeigen – kurz ihn durch alternative Produktion zu kritisieren.
Wenn der Sphäre der Öffentlichkeit die Fiktion entspricht
und der Sphäre des
Privaten die Theorie – so sind Theoriefiktionen
(oder Genealogien) Techniken der Verbindung beider
Sphären.
Durch sie werden Interdependenz,- sowie Reziprozitätsverhältnisse
artikuliert und verwirklicht, in jeweils konkret lokalen Konflikten.
Nun ist es aber völlig
uneinsichtig warum diese „Politik
der Minderheiten“ asozial sein soll – denn wenn die
Identität eines Subjekts sich durch vielerlei Erzählungen
definiert, und
wenn die Erzählungen auch (wie bei Foucault)
den Umweg über die Problematisierung der
Entstehungsmechanismen
von Subjekten nehmen – so ist Solidarität durchaus
gegeben. Im Produzieren von gesellschaftlicher Spezifität
sind konkrete Zusammenhänge der
Solidarität möglich
und nötig. Als Beispiel mögen hier, aufgrund ihrer Aussagekraft,
Diskussionen um ethnische Identitäten, Geschlecht und Sexualität
[10]
genannt sein. Dabei widerspricht
dies eindeutig nicht Rortys These der politischen Signifikanz
von Fiktion. Wenn wir uns mit Hilfe von Erzählungen jedoch
„sensitiv“
gegenüber anderen Menschen machen
können, so steht die Frage im Raum wieso dies im Kontext
von Theoriefiktionen nicht der Fall sein soll – problematisieren
diese doch
Identität und Kontext, machen Vorschläge
– hinweisend auf den polymorphen Bereich der
Virtualitäten,
que(e)r zu binär codierten Identitäten liegend. Die
Dimension des Zusammenhangs, der vielgestaltigen Identität
dessen was man wird, die Anwesenheit von
„Anderem“
im eigenen Leben ist hochgradig politisch. Die Arbeit an ihr –
z.B. genealogisch-kritisch – dies wäre „Philosophie
als Aktivität“
– wie Michel Foucault sie nannte.
„Philosophie ist jene Verschiebung und Transformation der
Denkrahmen, die Modifizierung etablierter Werte und all der Arbeit,
die gemacht wird,
um anders zu denken, um anderes zu machen und
anders zu werden als man ist.“ [11]
Auf solchen Wegen trifft man Menschen. Und die sind bekanntermaßen
ja nicht unbedingt
egal.
Anmerkung
[1] Rorty, Richard: Kontingenz,
Ironie und Solidarität.
S.259. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag. 1992
[2] Foucault, Michel; Walter Seitter: Das Spektrum
der Genealogie. S.28. Bodenheim. Philo
Verlagsgesellschaft mbh.
[3] Rorty, Richard: S.142f.
[4] Ebd., S.156
[5] Negt, Oskar; Kluge, Alexander: Der unterschätze
Mensch. Band 1.
Gemeinsame Philosophie in zwei Bänden.
S.708. Frankfurt am Main. Zweitausendeins. 2001
[6] Ebd., S.717
[7] Ebd., S.354
[8] Lyotard,
Jean-Francois: Das Patchwork der Minderheiten.
Für eine herrenlose Politik. S.93 Berlin. Merve
Verlag.
1977
[9] Ebd., S.9
[10] Stellvertretend
sei verwiesen auf: Butler, Judith:
Körper von Gewicht. Gender Studies. Frankfurt am Main.
Suhrkamp Verlag. 1997
[11] Foucault, Michel: Von der Freundschaft. S.22.
Berlin. Merve Verlag. 1984