von Andre Reichert
Deleuze mit Schaub
Miriam Schaub:
Gilles Deleuze im Wunderland: Zeit- als Ereignisphilosophie und
Gilles Deleuze im Kino: Das Sichtbare und das Sagbare
Gilles Deleuze:
Das Bewegungs-Bild, Kino 1
Das Zeit-Bild, Kino 2
Was ist Philosophie?
„Die
Philosophiegeschichte übt in der Philosophie eine ganz offenkundig
repressive Funktion aus, sie ist der
eigentlich philosophische Ödipus:
'Du wirst doch wohl nicht wagen, in deinem Namen zu sprechen, bevor
du nicht dieses und jene gelesen hast, und diesesüber jenes und jenes über dieses.’
In meiner
Generation sind viele nicht heil da rausgekommen ... Aber vor allem
bestand meine Art, heil da rauszukommen...darin,
die Philosophiegeschichte als eine
Art Arschfickerei zu betrachten oder, was auf dasselbe hinausläuft,
unbefleckte Empfängnis.
Ich stellte mir vor, einen Autor von hinten zu nehmen und ihm ein Kind zu machen, das
seines,
aber trotzdem monströs wäre. Daß es wirklich seins war, ist sehr wichtig, denn der Autor
musste tatsächlich all das sagen, was ich ihn sagen ließ.“(Unterhandlungen, S. 14)
Die cinematographische Kunst entsteht als Lösung eines der
Hauptprobleme der
Philosophie im ausgehenden 19. Jahrhundert, für
das die historische Krise der Psychologie steht
(Deleuze). Die Position,
Bilder ins Bewusstsein und die Bewegungen in die Materie zu versetzen,
ist unhaltbar geworden. Wie von dem einen Bereich in den anderen
kommen? Wieso erzeugen Bewegungen
Bilder (Wahrnehmung), oder wie
ist es zu erklären, dass ein Bild Bewegung hervorbringt
(willensbestimmte
Handlung). Deleuze nennt zwei Autoren, die sich der Aufgabe annahmen,
die Dualität von Bild und Bewegung, Bewusstsein und Ding zu
überwinden: Husserl und Bergson. Der
eine durch den Schlachtruf:
alles Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas (Husserl), der andere
dagegen: Bewusstsein ist etwas (Bergson). "Wie sollte da der
Film außer acht bleiben -
dessen Entstehung sich ebenfalls
zu dieser Zeit anbahnte und der mit seiner eigenen Existenz die
Evidenz eines Bewegungsbildes zu liefern vermochte? ... auf jeden
Fall befreit er das Subjekt aus
seiner Verankerung ebenso wie von
der Horizontgebundenheit seiner Sicht der Welt, indem er die Bedingungen
der natürlichen Wahrnehmung durch ein implizites Wissen und
eine zweite
Intentionalität ersetzt." (Kino1, S. 84 f.)
Und so findet Deleuze in Bergson einen ständigen
Begleiter
durch das Kino.
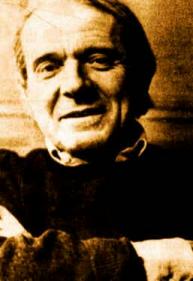
Gilles Deleuze
In Matiere et Memoire (1896) entwirft Bergson einen Bewegungsbegriff,
den Deleuze den neuen Formen der Bewegung annähert, die die
neue cinematographische Kunst mit ihren
Bildern bereitstellt. "So
wenig wie eine absolute Differenz zwischen Energie und Materie bestehe,
sowenig könne man Bewegungen und Bilder ein für allemal
unterscheiden; vielmehr
bildeten sie die jeweils extremsten Positionen
auf einer Skala mit fließenden Übergängen
und Austauschprozessen."(Schaub
2, S.89) Wenngleich für Bergson das Kino bloß falsche
oder illusionäre Bewegung zeigt, da es stillgestellte Bilder
eines Photogramms
nachträglich mittels eines Projektors in
Bewegung setzt, entleiht Deleuze ihm Begriffe wie Bewegung,
Ereignis,
Dauer usw.. Deleuze argumentiert sogar gegen Bergson, dass nicht
die Bewegung,
die uns der Film zeigt, sich einer falschen Natürlichkeit
bedient, sondern jegliche Bewegung auf einer
Illusion beruht, auf
Diskontinuität, Heterogenität und deren Synthetisierungen.
Hier setzt die Arbeit von Miriam Schaub ein, die in Deleuze`s Kinophilosophie
Perspektiven für die Philosophie der Zeit findet. Schon in
den Bewegungs-Bildern (Kino 1) und nicht
erst in den Zeit-Bildern
(Kino2) zeigt sich, wie Deleuze dem Kino-Bild eine zeitliche Dimension
abgewinnt, die sich nicht aus dem Gezeigten erschöpft, so die
These. Genau wie die
natürliche Bewegung besteht auch das Bewegungsbild
in einem Wechsel der Dauer, einem Bewegungsschnitt,
wie Deleuze
sagt, einer Verlagerung im Raum und zugleich einem Wechsel der Qualität
(Bergsons Beispiel: Wenn ich Zucker in ein gefülltes Wasserglas
gebe und einige Zeit warte, so erhalte
ich nicht Wasser plus Zucker,
sondern Zuckerwasser). Die ontologische Grundlage des Kinos ist
in den nicht zentrierten, nicht abgeleiteten, nicht abgelenkten,
nicht wahrgenommenen, herrenlosen
Bildern (Schaub), in einem Chaosmos
gegeben. "Es ist eine Welt universeller Veränderlichkeit,
universeller Wellenbewegung, des Universellen Plätscherns:
In ihr gibt es weder
Achsen noch Zentrum, weder rechts noch links,
weder oben noch unten." (Kino 1, S. 87) In diesem
chaotischen
Zustand reagieren die reinen Bewegungsbilder noch unmittelbar miteinander,
ohne jegliche Verzögerung, zumal weder ihre räumliche
Grenze noch ihre zeitliche Dauer bestimmbar
sind. Die Identität
von Bild und Bewegung wird erst aufgegeben, durch das Auftreten
einer zirkulierenden Leerstelle, die sich als Intervall zwischen
zwei Bilder schiebt. "Und das Gehirn
ist nichts anderes: Intervall,
Abstand zwischen Aktion und Reaktion. Das Gehirn ist gewiss kein
Zentrum von Bildern, das man als Ausgangspunkt nehmen könnte,
sondern es stellt für sich
selbst ein besonderes Bild unter
anderen dar, ein Indeterminiertheitszentrum im nicht-zentrierten
Universum der Bilder."(Kino 1, S. 92) So transformiert sich
das reine Bewegungsbild in
Bewegungsbilder mit einem zweifachen
Bezugssystem. In einem ersten System variiert jedes Bild in sich
und alle Bilder reagieren und wirken wechselseitig aufeinander.
In einem weiteren System
variieren alle Bilder prinzipiell auf ein
einziges Bild, wobei dieses die Einwirkung der anderen Bilder auf
seiner einen Seite empfängt, während es auf der anderen
Seite darauf reagiert.
Da Deleuze von der Gesamtheit der Bilder
ausgeht, wird die Bild-Materie-Ebene nicht verlassen.
Miriam Schaub versucht jetzt, die Leseerfahrung aus Logik
des
Sinns und Differenz und Wiederholung in ihrer
praktischen Anwendung (, in der Theorie des
Kinos?) zu zeigen (Theorie/Praxis?).
Denn in dem Chaosmos der Bewegungsbilder bleibt nur die Vorstellung
einer reinen Gegenwart, die keinerlei Verbindungen zu vergangenen
und zukünftigen
Zeiten unterhält, eine Gegenwart ohne
Subjekte und Gedächtnis, in der man erlebte Zeit erinnern
und
künftige Zeiten antizipieren kann. Diese Zeit gibt aber auch
etwas Neues,
Mögliches und schafft durch ihre rettende Wiederholung
eine Wiederkehr (des Glaubens, Bunuels
Würgeengel). Die rettende
Wiederholung bejaht alle vergangenen wie künftigen Wiederholungen
und stellt deshalb keinen Bruch dar. In dieser derealisierten Gegenwart,
diesem Metafilm hat
potentiell jeder Augenblick die Möglichkeit
zur Zäsur, Ereignis zu werden "in seiner
„uranfänglichen
Komplikation“ (PZ 40), deren sinnfälligster Ausdruck
die „Außerzeitlichkeit“ der „Zeit im Zustand
der Geburt“ (ibid.) ist, welche
alle diese Ereignisse virtuell
in sich schließt. In späteren Büchern wählte
Deleuze hierfür andere Begriffe: im Kant-Buch ist
es die 'gerade
Linie’ als schlimmstes Labyrinth von allen,
in Differenz und Wiederholung Zeit als 'leere
Form’
der dritten Synthese, in Was ist Philosophie? ist es „die
Unermesslichkeit der leeren Zeit, in der man sie noch als künftige
und schon als geschehene
sieht“ (Ph, 184 f.), eine Art „Zwischen-Zeit(entre-temps)“
(ibid.), wie es sich
auch später im Zeit-Bild (1985)
in Gestalt des unermesslich werdenden Intervalls des
inexistenten,
fehlenden Zwischen-Bilds(interstice) als ultima ratio des
falschen
Anschlusses (faux accord) präsentiert."
(Schaub 1, S. 272)
Im gesamten Werk von Deleuze findet Schaub die Vorstellung, dass
die Gegenwart mit
sich selbst koexistiere (virtuelle Koexistenz)
als schon-vergangene und als noch-zukünftige, wobei
diese virtuellen
Begleitzeiten nichts verdoppeln, sondern hier das An-sich des Virtuellen
(Bergson) aufscheint. "Egal, ob es um die Koexistenz
des jeweils gegenwärtigen
Augenblicks mit sich selbst als bereits
abgeschlossenen und als noch zukünftigem (vgl. N, 53; PZ, 49)
geht, oder um die Koexistenz der Gegenwart mit sich selbst als abgeschlossene
und immer
noch offene (vgl. N, 54; DW, 113), oder um die Koexistenz
des Werdens mit sich selbst als eines, das weder
Anfang noch Ende
hat und damit gleichermaßen ‚nie angefangen’ hat
und
'nie enden’ wird (vgl. N, 53), immer erklärt Deleuze:
Wenn es anders wäre, würden der
Augenblick und das Gegenwärtige
nicht vorübergehen, würde nichts werden."(Schaub
1, S. 273) Ein Werden wird erst ermöglicht durch eine assymetrische
Spaltung des
Gegenwärtigen, die die Koexistenz des Sukzedierenden
mit sich als bleibenden bedeutet, Bewahren und
Bruch zugleich. Doch
wie komme ich auf die Höhe des Sichvollziehenden, des eigenen
Werdens und Denkens? Schaub antwortet: Deleuze benötigt eine
Parallelwelt, von der aus sich der
Vollzug beobachten läßt,
denn man muß immer in zwei Vollzüge verwickelt sein,
um einen übersehen zu können."Heideggers Sein
und Zeit, Deleuzes
Differenz und Wiederholung
sind Namen für eine solche Strategie, einen Begriff durch
den
jeweils anderen - in jeweils anderer Hinsicht - gegenzuverwirklichen;
wobei beide
Begriffe in ein Anders-Werden verwickelt sind."
(Schaub 1, S. 276) Durch die Einrichtung dieser
Parallelwelten entgeht
Deleuze den performativen Widersprüchen des Selbstvollzugs.
Bei Deleuze wird der Vollzug also nicht stillgestellt, um dessen
Wahrheit zu enthüllen, sondern er
wird potenziert durch ein
Springen zwischen den Vollzügen, durch ihre Vervielfachung.
Die Philosophie ist bei Deleuze nicht Geschichte, sondern Werden;
nicht Abfolge von Systemen, sondern die
Koexistenz von Ebenen.

Kino in Paris
Jetzt gibt es aber zwei Kinobücher, Das Bewegungsbild (Kino
1) und das
Zeitbild (Kino 2). Miriam Schaub hat mehrere Antworten
gefunden, wobei die zeittheoretische die
grundlegende bleibt. Ist
es ihr beim Bewegungsbild gelungen, Zeit zwischen Sukzession und
Simultanität zu denken, so gilt es nun im Zeitbild Zeit als
reine Simultanität zu finden. Schaub
argumentiert, dass Kino-Bilder
als vorgeführte zwar sukzessiv sind (in Analogie zur Schrift
oder zum gesprochenen Wort), nur im Moment ihrer Aktualisierung
sichtbar werden. Jedoch können
die Filmbilder Zeit anders zeigen,
als beispielsweise die Sprache, die auf drei Modi, die nicht zugleich
der Fall sein können, beschränkt bleibt. Cinematographische
Bilder imitieren
unsere modale Wirklichkeits - und Zeiterfahrung
nur, teilen sie aber nicht. "Was immer ein Bild zeigt,
seine
Zeitlichkeit ist immer Produkt einer Inszenierung, immer ein Akt
der
Überschreitung, eine Behauptung, die durch keine genuin
zeitliche Verfassung des Bildes gedeckt
wäre. Genau deshalb
kann es eine Zeitlichkeit in Szene setzen, die unseren
sukzessionslogischen Konventionen, unseren Denk-, Vorstellungs-
und Bildgewohnheiten zuwiderläuft,
weil es kein Bewusstsein,
kein modales Zeitbewusstsein seiner eigenen zeitlichen Aktualisierungsbedingungen
haben muß." (Schaub 2, S. 276) Weil das Kinobild das
Sichtbare und das Sagbare
simultan in sich einschließt, als
zwei getrennt zu inszenierende Ordnungen, kann es eine performativ
richtige und triftige Darstellung des darstellungstheoretischen
Dilemmas der Zeit als
Sprache liefern. "Das stimmt tröstlich."(Schaub
2, S. 114)
Die zu Beginn ach so klassisch wirkende Frage, hat eine neue Antwort
bei Deleuze gefunden.
Deleuze, der die Zeit zwar nie nur sukzessiv
gedacht hat, dem Modell der Zeit als Sprache aber nie ganz
entkam.
Geleitet durch die, von Schaub als Deleuzesche Sehnsuchtsformel
hervorgehobene
Wendung von Proust: Un peu de temps à
l' état pur, zeigte sich Zeit im gesamten
Werk von Deleuze
- selbst im Anti-Ödipus findet Schaub im 'Psychischen als Maschine’
einen Decknamen, unter dem zeitliche Prozesse analysierbar werden.
Und so wird auch ein Denken in
Theorie und Praxis durchgehalten:
"Den im ersten Teil entworfenen Zeitmodellen werden im zweiten
Buch Doubles, Anwendungsfälle in Bildern an die Seite gestellt.
Wir werden sehen, dass die
in Differenz und Wiederholung
beschriebene 'rettende Wiederholung' der dritten Synthese, am
Beispiel
eines Bunuel-Films wie Der Würgeengel nachgeholt,
eine
natürliche Anwendung erfährt. Lewis Carrols Teegesellschaft
mit ihren getrennten Inszenierungen
von äonischer und chronologischer
Zeit aus Logik des Sinns kehrt wieder in leicht
veränderter
Gestalt im Film Letztes Jahr in Marienbad"(Schaub
2, S.
25). Wobei die Theorie unbefriedigend endete, in der Praxis
fortbestand und eine neue Antwort in der
Anwendung möglich
wurde. Schaub zeichnet eine Entwicklungslinie im Deleuzeschen Denken,
das sich an Klassikern der Philosophiegeschichte misst (Kant, Hegel,
Heidegger ...). An einem Leitmotiv,
die Frage nach der Zeit, wird
planmäßig das Deleuzesche Werk abgeschritten, einem Leitmotiv,
dem der Leser und auch Deleuze sich fügen müssen. "Ich
nähere mich
hier eher konservativ, schulmäßig den
Texten, klopfe sie auf Thesen ab, versuche wiederkehrende
Gedankenfiguren
in eine diskutierbare Form zu bringen, forsche nach werkimmanenten
Gründen für offensichtliche Vorlieben und Merkwürdigkeiten,
spitze vielfach zu, werfe Fragen
auf, probiere Antworten oder muß
passen"(Schaub 1, S. 43), charakterisiert Schaub ihr Vorgehen
selbst.
Bei Deleuze ist das Kino jedoch vielmehr "eine
neue Praxis
der Bilder und Zeichen, und es ist Sache der Philosophie, zu dieser
Praxis
die Theorie (im Sinne begrifflicher Praxis) zu liefern."
(Kino 2, S.358) "Denn Theorie ist ebenso
wie ihr Gegenstand
etwas, das man macht. Für viele Leute ist Philosophie etwas,
das
nicht »gemacht« wird, sondern immer schon fertig
in einem Ideenhimmel existiert." (Kino 2,
S. 358 f.) Die philosophische
Praxis der Begriffe ist keineswegs abstrakter als ihr Gegenstand,
da die Philosophie nicht über ihren Gegenstand handelt, sondern
über die von ihm
hervorgebrachten Begriffe. Die Frage, die
sich für Deleuze stellt, ist also nicht die, nach dem
Vorrecht
einer Praxis gegenüber einer anderen, sondern vielmehr: in
welchen
Verhältnissen stehen die Begriffe, was sind die korrespondierenden
Praxen? Philosophie ist für
Deleuze Konstruktivismus: eine
Immanenzebene erschaffen, auf der sich singuläre Begriffe gruppieren,
wobei diese nicht ein Puzzle ergeben, sondern Würfelwürfe
wagen. Die Begriffe
können also nicht an einer Grammatik gemessen
werden, weil sie keine Propositionen sind. Propositionen
definieren
sich durch ihre Referrenz, einen Bezug zum Sachverhalt und ebenso
die
Bedingungen dieses Bezugs. Die Begriffe hingegen sind Schwingungszentren,
deshalb herrscht überall
Resonanz, nicht Abfolge. "Als
fragmentarische Totalitäten sind die Begriffe nicht einmal
Teil eines Puzzles, da ihre unregelmäßigen Umrisse einander
nicht entsprechen. Sie
bilden wohl eine Mauer, eine unverfugte Trockenmauer
allerdings, und wenn alles zusammengetragen ist, so
auf auseinanderlaufenden
Wegen. Selbst die Brücken von einem Begriff zum anderen sind
noch Kreuzungen oder Umwege, die keinerlei diskursiven Zusammenhang
umschreiben." (Was ist
Philosophie?, S.30)